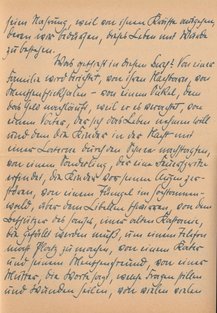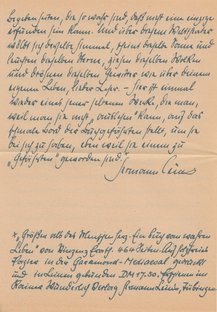Bücher (Auszüge)
Vinzenz Erath: Größer als des Menschen Herz.
Auszüge aus: Vinzenz Erath: Größer als des Menschen Herz. Ein Buch vom wahren Leben. Verlag Hermann Leins, 1951.
Inhalt
Zum Autor und Worte des Verlegers
Engel des Lebens
Der Kastanienbaum
Natur und Elemente
Die Gottesmutter von Mariabronn
Der Schutzengel
Neue Wunder
Die neue Zeit
Das erste Ich-Erleben
Das Geheimnis der Hostie
Sünde und Kommunion
Die Base, ihr Sohn und die Tochter des Eschhofes
In die große Welt
Zum Autor und Worte des Verlegers
Vinzenz Erath (1906-1976) wurde als zehntes Kind eine Kleinbauernfamilie im Schwarzwald geboren. Nach einigen Semestern Theologie- und Philosophie-Studium schlug er sich zunächst mit Fabrikarbeit, dann als Hauslehrer durch, nach dem Krieg unter anderem als Waldarbeiter und Streckenarbeiter bei der Bahn, bis 1951 sein erster Roman ein Bestseller wurde, der eine Gesamtauflage von über 250.000 Exemplaren erreichte.
Der Verleger Hermann Leins (1899-1977) durfte nach 1945 als erster Verleger wieder in der französischen Besatzungszone wirken. Treuhänderisch verwaltete er zunächst unter anderem auch die Deutsche Verlags-Anstalt und war ab 1965 Alleininhaber der Metzler’schen Verlagsbuchhandlung und des Verlags Carl Ernst Poeschel. In seinem Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins erschien 1934 der Briefroman „Das Herz ist wach“ seiner späteren Schwiegermutter Gertrud von Sanden (diese war seit 1930 Lebensgefährtin der Frauenrechtlerin und Politikerin Gertrud Bäumer, die eng mit Friedrich Naumann zusammenarbeitete).
1951 verlegte Leins dann den Roman „Größer als des Menschen Herz“ von Vinzenz Erath, über das er im Umschlageinband schreibt:
Vor zwei Jahren las ich die ersten Manuskriptseiten dieses Buches, das die sieben Farben des Lebens im Kristall einer wahrhaftigen Menschenseele aufleuchten läßt. Seine Gestalten werden zu Akteuren einer Weltbühne, auf der alles gespielt wird, was unser Dasein gefährdet und groß macht: Haß und Liebe, Hoffart und Demut, Verbrechen und Unschuld, Übermut und Gottesfurcht. Seit der ersten Begegnung mit dem Verfasser war ich von Unruhe erfüllt, ob er, dessen Werk mit den großen Romanen der deutschen Literatur die Liebe zum Menschen teilt, wohl die Kraft habe, die unbändige Erlebnisfülle seiner Welt in ein gestaltetes Kunstwerk zu schließen. Schritt für Schritt begleitete ich ihn auf seinem Weg zwischen Hoffen und Verzagen, aber das gemeinsame Sorgetragen wurde belohnt: Dieses Buch ist das Kernstück der Werke, die ich im 25. Jahr des Bestehens meines Hauses neu hinausgebe. Mit der großen Darstellung des Verlagszeichens auf dem Umschlag will ich bekunden, daß sich das Wollen des Verfassers ganz und gar mit meinem verlegerischen Strebend trifft: über dem rollenden Rad der Zeit, über dem wechselvollen Los und der Vergänglichkeit des Menschenlebens immer wieder auf die Sterne zu deuten, unter denen wir geboren sind, um gemeinsam zu lieben, zu leiden, schuldig und erlöst zu werden. – Ich verspreche nicht gerne – hier verspreche ich das große Bucherlebnis allen, die den Mut haben, sich ergreifen zu lassen, allen, die guten Willens sind.
Hermann Leins
Ich besitze einen handschriftlichen Brief, in dem er schreibt:
Als Buchhandelslehrling gehörte auch ich zu den Menschen, die den Inhabern derjenigen Verlage ein gerüttelt Maß von Bewunderung entgegenbrachten, die es verstanden, ihre, was man so leichthin mit „Produktion“ bezeichnet, einem „Gesicht“ einzufügen. Wenn man aber selbst auf eigenes 25jähriges verlegerisches Bemühen zurückblicken darf, dann wird man gewahr, daß es wohl darauf ankommt, die Wege zu wissen, die man nicht gehen will, daß es aber wichtiger ist, sich fernab der Straßen literarischer Strömungen und Weltanschauungen treu zu bleiben und zu warten, bis sich einer jener seltenen „Sternstunden“ im Leben des Verlegers einfindet, in der beileibe nicht ein druckfertiges Manuskript, wohl aber ein Brief, ein Entwurf auf seinem Tisch liegt und er plötzlich erfährt: Hier ist Einer, dessen Anliegen das deinige ist. So ist’s mir ergangen, als ich die Geschichte des Hampel in Löschers „Alles Getrennte findet sich wieder“ zu Gesicht bekam, als ich den Brief las, in dem Ben, der Held des Buches „Das Herz ist wach“, der Freundin vom Sterben seiner Frau berichtet, als ich las wie in dem Roman Isabel Hamers „Perdita“ der lebenssichere Onkel John seiner in Not geratenen Nichte von einem Fehler in seinem Leben erzählt. – So erging es mir in dem vergangenen Jahr, als die erste Fassung des Lebensberichts eines „Gelegenheitsarbeiters“ zu mir kam. Unterdessen sind es vier Fassungen geworden, die dieser Bericht erlebte, und aus dem Bericht ist ein allgemein-menschlich gültiges Dokument geworden – ein Buch vom wahren Leben, das ich mit Bangen und Hoffen der Öffentlichkeit übergebe. Mit Bangen, weil ich fürchte, es könnte in die falschen Hände geraten, mit Hoffen, weil ich weiß, daß es zu den Werken gehört, von denen Josch Hofmiller sagt, sie seien Nahrung, weil von ihnen Kräfte ausgehen, deren wir bedürfen, dieses Leben mit Würde zu bestehen.
Was geschieht in diesem Buch? Von einer Familie wird berichtet, von ihren Nachbarn, von Menschenschicksalen – von einem Onkel, dem das Geld wegläuft, weil er es verachtet, von einem Vater, der sich das Leben nehmen will und dem die Kinder in der Nacht mit einer Laterne durch den Schnee nachstapften, von einem Sonderling, der eine Feuerspritze erfindet, die Kinder vor seinen Augen zerstören, von einem Tümpel im Hochtannenwald, über dem Libellen schwirren, von dem Beschützer des hauses, einer alten Kastanie, die gefällt werden muß, um einem Telefonmast Platz zu machen, von einem Kater und seinem Menschenfreund, von einer Mutter, die Worte sagt, welche Fragen stillen und Wunden heilen, von vielen vielen Begebenheiten, die so wahr sind, daß nicht eine einzige erfunden sein kann. Und über diesem Welttheater wölbst sich derselbe Himmel, scheint dieselbe Sonne und leuchten dieselben Sterne, ziehen dieselben Wolken und dröhnen dieselben Gewitter wie über deinem eigenen Leben, lieber Leser. – Hier ist einmal wieder eines jener seltenen Werke, die man, weil man sie nicht „auslesen“ kann, auf das schmale Bord der Buchgefährten stellt, um sie bei sich zu haben, eben weil sie einem zu „Gefährten“ geworden sind.’
Hermann Leins
* „Größer als des Menschen Herz. Ein Buch vom wahren Leben“ von Vinzenz Erath. 464 Seiten. Auf Holzfreies Papier in der Garamond-Mediaeval gedruckt und in Leinen gebunden Diabetes mellitus 17.50. Erschienen im Rainer Wunderlich Verlag Hermann Leins, Tübingen.
Engel des Lebens
Was habt ihr gewonnen, ihr Menschen, wenn ihr die Erde ihrer Gottheit entkleidet und die himmlischen Mächte hinter die Sterne verbannt? Ist er nicht göttlich, der Wasserfall zwischen bemoosten Steinkuppen, wenn das Wasser in gläsernen Strudeln zwischen Granitblöcken sich tummelt und in schäumenden Kaskaden über Steinbänke springt, tollend und donnernd und rauschend. Seit Jahrtausenden erquickt er die Augen der Menschen, die Seelen der Kinder, reißt das Innere auf zur Freude und Begeisterung. Steht er nicht höher da im Werte vor Gott als du, als alle Erzieher, weil er ewig ist, weil sein Engel über ihm steht.
Und es ist derselbe Engel, der die Wolken auftürmt zu Gebirgen, kühn und majestätisch.
Was hast du gewonnen, wenn du nur in den Gerippen der Gesetze herumfingerst, ohne den Pulsschlag zu fühlen, der dich und die Schöpfung vereint.
Die Wolken sind ewiger als du, und bevor du warst, stiegen sie auf am Himmel und werden aufsteigen, wenn du längst nicht mehr sein wirst.
Sieh, wie die Nebel aus den Wäldern schleichen, wie sie scheu und schemenhaft Wiesen und Mulden füllen. Waren sie nicht größer, jene Menschen, die hinter den wallenden, weißen Linn göttliche Wesen schauten, göttlich, weil kein Werden und ergehen die ewig reine und immer gleiche Erscheinung berührt?
Bist du vielleicht wacher als das Kind, wenn du die Schneeflocke in einer Zahlenformel auszusagen glaubst, anstatt mit demutsvollem Staunen den Engel zu preisen, der die tanzende Lust aussät über die Erde?
Und wenn die Wasser vom Himmel fallen, sich sammeln zu Bächen, Flüssen und Strömen, um wieder heimzukehren ins ewige Meer, glaubst du, deine Seele wüßte nicht Trost zu schöpfen aus dem großen Bilde des Lebens, das der Engel hinbreitet, um dich wissen zu lassen, wie jedes Leben den gleichen Weg geht. [...]
Oder sieh, wie das Kind am Feuer hockt und verhext ist vom gefährlichen Spiel der prasselnden Flamme. Wie es ins Kerzenlicht starrt, wie es aufblickt, wenn die ersten Sonnenstrahlen in die Stube fallen.
Engel des Lichtes! Engel der Farben!
Dort wandert er mit dem Kind durch die Wiese, entlang am Ackerrain, und zeigt ihm Tausende von Blumen: das Gänseblümchen, die Primel und Anemone, die Kuckucksnelke und das Schaumkraut, den großen Löwenzahn und die Sumpfdotterblume. Sieh, wie er ihm die Trollblume in die Hand drückt und das Vergißmeinnicht. Alle darfst du pflücken, alle, soviel du kannst, sagt er hochherzig. Ich lasse sie wieder wachsen.
Und es pflückt mit zitternden Händen, legt das Gesicht hinein in die Farben. Wie sie duften! o immer wieder und wieder steckt es sein Näschen in die wohlige Fülle.
Darf ich mir ein Bettchen machen? fragt es.
Ja, komm! sagt der Engel, hier zu Häupten die Trollblumen, hier die Vergißmeinnicht. Wir müssen noch viel mehr Blumen holen. Bald liegt das Kind selig in einem blühenden Bett, schließt die Äuglein und hört den Engel flüstern: Du bist im Himmel, so schön ist der Himmel, so duftig und farbig und weich.
Kränze hilft er ihm flechten aus Margeriten und Girlanden aus Löwenzahnköpfen. Er zeigt ihm das weiße, summende, singende Wunder des blühenden Birnbaums. Wie ein Gebirge steht er da.
Er streut Schmetterlinge, Käfer, Libellen, Fliegen, Hummeln und Bienen in die Luft wie Samen des Lebens.
Wenn der Sonnenball am Abend glühend über den Wäldern zittert, wenn Abend- und Morgenröten aufflammen und Himmel und Wolken eingetaucht sind in purpurner Trunkenheit, wenn wie eine Brücke zwischen Himmel und Erde der Regenbogen steht, das immer junge Farbenwunder, wenn im Winter alles in weißem Flaum versinkt, die Augen des Kindes sind unersättlich im Trinken, sie trinken den Wein des Lichtes ins dämmernde Dunkel seines erwachenden Daseins.
Engel des Lebens möchte ich sie heißen, die vier großen, erhabenen Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht, die als Erzieher an der Wiege des Menschen stehen. Engel, weil sie ewig sind, Former der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, göttliche Schöpfer des Lebens.
Wer ihre Hände losläßt, verliert das Kind in der Brust und damit die eigene Ewigkeit. Die Formen sind sterblich. Der Baum wächst und altert und stirbt, nicht aber die Blüte, sie bleibt jung. Unser Körper wächst und altert und stirbt, nicht die Seele. Seele aber ist das ewige Kind in uns, ist gläubige Geborgenheit in den Händen der Engel des Lebens. [82-85]
Der Kastanienbaum
Der erste Eindruck, den ich vom Leben empfing, war ein grünes Tanzen von Blättern vor dem Fenster. Zwischen den Blättern tanzten Lichtstrahlen, die gegenüber an die Ofenwand helle Flecken warfen. Auch diese tanzten auf und nieder. Wenn ich allein dalag, konnte ich stundenlang diesem Spiele zusehen. Später, wie ich zum Fenster emporklettern konnte, sah ich das ganze Wunder. Ein gewaltiges grünes Etwas stand da, über und über bedeckt mit weißen Lichtern, die im Laub und Gezweige schimmerten. Es war unser Kastanienbaum. Zwischen Garten und Hofraum ragte er auf als schirmender Wächter. Seine Äste deckten die Hälfte des Daches, überschatteten den Brunnentrog und den Dunghaufen, breiteten sich über die Straße aus, über den Gemüsegarten und türmten sich hoch in die Luft wie ein grüner Berg. Sein Rauschen war mein Wiegenlied, mein Tag- und Nachtgesang, sein Grün mein erster Morgengruß, seine Größe war mir ein erster Inbegriff von Erhabenheit, Wucht und Majestät, sein Blühen ein unerschöpflicher Quell der Augenlust und Seelenfreude. Lange Zeit glaubte ich, es gäbe auf der Welt nur einen einzigen Kastanienbaum, und der gehörte uns. [...]
Aber erst am Fronleichnamstag bekam der Baum seine volle Bedeutung. In jeder Straße im Dorf durfte ein Altar aufgestellt werden, und mein Großvater Lukas Rainer hatte es durchgesetzt, daß auch der Rote Weg seinen Altar bekam, und zwar vor seinem Haus unter dem Kastanienbaum. An diesem Tag ging Mutter wie in einem Taumel himmlischen Glückes umher. Da stand dann ein großer Strauß von Kastanienblättern auf dem Tisch, gepflückt von dem Ast, der über dem Allerheiligsten geschwebt hatte. Zu uns Kindern aber sagte sie: „Heute hat Gott zu unserm Fenster hereingesehen“, und aus ihren dunklen Augen strömte uns eine Ehrfurcht entgegen vor etwas, das unser kindliches Begreifen weit überstieg. [...]
Dieser Glaube vertiefte sich bald, als ich an einem Wintermorgen von meiner Mutter geweckt wurde mit den Worten: „Florian, komm, steh schnell auf, du mußt dir unsern Kastanienbaum betrachten.“ Sie führte mich in die Stube ans Fenster, und da erlebte ich ein Wunder, das meine Seele vor Andacht erschauern ließ. Der Baum glänzte wie übersät mit Tausenden von Edelsteinen. Die Morgensonne überstrahlte ihn mit einem rötlichen Schimmer. Ganz mit Rauhreif bedeckt stand er da. Ein Sprühen und Funkeln, ein Perlen und Schäumen von Farbe und Licht schlug mir entgegen. Eine Märchenburg, ein Zauberechloß ragte empor! Ich konnte das Wunder kaum fassen. „Wer hat das getan?“ fragte ich scheu meine Mutter. Und wieder fiel jenes Wort, aber diesmal so tief wie ein Stein auf den Grund eines Brunnens, das Wort: Gott.
Wer gab dir, große Mutterseele, den Gedanken ein, in diesem Augenblick, da mein Herz zum ersten Mal weit weit offen stand, mir jenes Wort ins Ohr zu flüstern, das bis heute wie ein spitzer Edelstein in mir liegt und mich nie mehr zur Ruhe kommen läßt? [85-89]
Natur und Elemente
Zwischen dem Häuschen des Schindelmachers und Ottmars Bauernhaus, genau gegenüber unsern beiden vordern Stubenfenstern, befand sich ein breiter Rasenplan, nur besetzt von einigen schiefen, kümmerlichen Birnbäumen. Wie ein breites Tor war diese Lücke und gab eine Aussicht frei weit ins Feld hinaus, bis zum Tannenwald, der für mich lange Zeit die Welt abschloß.
Wie oft sah ich dort über den Wipfeln den purpurnen Sonnenball hinabsinken oder ein Abendrot aufglühen, ein Lohen von Flammen. Wenn Gewitterwolken sich zusammenzogen, schaumweiß und stumm, hing mein Blick gebannt an den Himmelsgebirgen, den langsam hochquellenden Massen, die aus dunklen, geheimnisvollen Gründen sich türmten und übertürmten. Sie waren mir Botschaften aus anderen Welten, berauschende Farbenspiele der Natur, die man mit Augen trinken konnte, ohne je satt zu werden.
Oder wenn der Schnee schmolz, wenn der Föhn die Wälder peitschte, daß man ihr Brausen bis in die Stube vernehmen konnte wie fernes Gefälle vieler Wasser, und Wolkenballen uni Wolkenballen wie endlose Viehherden am Himmel entlanggejagt wurden, immer über mich hinweg, und ihre Nebelfetzen oft an der Erde entlangschleiften, wenn es heulte und jaulte, stöhnte und jubelte, fauchte und toste, ach, du kleines Herz am Fenster, wie war deine Lust so groß, dein Tor so weit, dein Verlangen so bang in der Brust!
Der Schnee ging, die Wasser stürzten aus den Wäldern, der Rotbach schwoll an zum Fluß, zum Strom, trat in die Wiesen und bildete Teiche und ganze Seen. Alles glänzte und silberte, alles rief und lockte: Komm heraus, Florian, schau mich an, mich den Rotbach, kennst du mich noch? Und ich eilte hinaus zu ihm und zum Wald und sah, wie aus jedem Ackerstreifen Bäche schossen, wie es rieselte und blitzte und quirlte in den Wiesen. [127-128]
Die Gottesmutter von Mariabronn
Der Tod der kleinen Agnes lag als Schatten wochenlang auf unserer Familie. Vater war verschlossen und unnahbar, meine Brüder wurden verdrossen und Mutter verfiel wieder ganz in ihre Grübelei. Sie saß Abend für Abend mit dem Rosenkranz auf der Ofenbank und überließ Mathilde den Haushalt. In qualvollen Selbstvorwürfen schien sie sich zu peinigen und es als Strafe Gottes aufzufassen, daß sie in ihrer Liebe einen Unterschied zwischen mir und Agnes gemacht hatte. Sie pflegte mich plötzlich mit einer Zärtlichkeit und Hingabe, die wie ein warmer Sommerregen in meine von Bitternissen ausgedörrte Seele fiel.
Ich hatte ja nur auf diesen Augenblick gewartet, und im Sturm flog ich an ihr Herz. Es war ein so unsagbar schweres, großes Glück, daß ich ihr mit allen erdenklichen Bezeugungen der Gegenliebe meine Dankbarkeit beweisen wollte. Ich weiß, wie ich oft viele Stunden nach Erdbeeren im Walde suchte und keine aß, um alle meiner Mutter zu bringen, wie ich nach seltenen Blumen Ausschau hielt und ihr die Sträußchen in die Hand drückte, wie ich ihr gefallen wollte, indem ich abends recht fromm mit ihr betete. Und wenn sie die wunden Stellen an meinem Körper behandelte, hielt ich tapfer ohne Laut die Schmerzen aus. „Ach“, stöhnte sie oft, „was soll ich nur mit dir anfangen, Bub, das hört ja gar nicht auf mit deinen Eiterbeulen.“
Zuletzt nahm sie ihre Zuflucht zu einem Mittel, das ganz im Bereich ihrer Vorstellungen lag. Unweit meines Heimatdorfes, nur eine halbe Wegstunde entfernt, liegt das Nonnenkloster Mariabronn, eine Anstalt für Blinde, Taubstumme und Waisenkinder, die von Schwestern vom Orden des heiligen Franz von Assisi versorgt werden, und ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Man erzählte sich von manchen Wundern, welche auf die Fürbitte der Gnadenmutter von Mariabronn geschehen sein sollen. Dorthin wollte mich Mutter mitnehmen und empfahl mir, ich möchte schon im voraus recht innig um Heilung beten, dann werde die Gottesmutter vielleicht helfen. Ich tat es, und die Aussicht, von meinem Leiden geheilt zu werden, gab meinem kindlichen Beten den nötigen Ernst.
Der Bittgang wurde unternommen. Es war ein feierliches, tief in meine Seele einschneidendes Erlebnis, als ich mit meiner Mutter an einem Sonntagmittag auf der Landstraße nach Mariabronn mit ihr zusammen den Rosenkranz betete. Bald wurden hinter einem Hügelrücken die beiden Türme der Wallfahrtskirche sichtbar, bis wir von der Höhe aus die ganze Anstalt mit ihren vielen Gebäuden daliegen sahen.
Wir nahmen zuerst am Gottesdienst teil. Ich sah Nonnen in langen, schwarzen Gewändern paarweise durchs Mittelschiff der Kirche schreiten, sah Blinde sich an den Bänken hintasten, sah Taubstumme, Waisenkinder, und ein wehmütiger Zauber stillen Leidens lag über allem.
Nach dem Gottesdienst gingen wir hinunter zur Krypta, deren Wände über und über mit Votivtafeln behangen waren. Die eigentliche Gnadenkapelle war ein kellerartiger, gewölbter Raum, an dessen Stirnseite zwischen Tuffsteinen in einer Nische das alte Gnadenbild, eine schwärzliche Muttergottes mit dem Leichnam Christi auf dem Schoße stand. Eine Fülle von Blumen rahmten es ein. Unterhalb des Bildes plätscherte aus einem Stein ein Brünnlein in ein Becken. Es war das Gnadenwasser, aus dem eine Nonne mit einem Becher den Umstehenden zu trinken gab. Der Raum war angefüllt von Betern: Männern, Frauen und Kindern. Manche ließen sich Wasser von dem Brünnlein in Flaschen abfüllen. Auch meine Mutter hatte eine Flasche bei sich und reichte sie der Nonne hin. Wir beteten lange und tranken von dem Wasser. Mutter netzte damit mein Gesicht und meine Hände und flüsterte in mein Ohr: „Du mußt jetzt fest glauben, daß du gesund wirst, und ganz fromm beten.“
O du heilige, gläubige Unschuld! Welche verzweifelten Anstrengungen machten mein Hirn und Herz, das große Wunder zu erzwingen, glaubte ich doch, jeden Augenblick könne wie auf einen Schlag mein Körper geheilt sein. Ich trug gerade einen Furunkel im Genick, der mir jede Bewegung des Kopfes zur Qual machte, und wartete nun zwischen Hoffen und Bangen, wie bald er verschwinden werde.
Weitere Menschen drangen in den kleinen Raum. Die Nonne mahnte, wir sollten den andern Platz machen. Mutter nahm mich an der Hand und sagte: „Komm jetzt!“ Ich aber flüsterte ihr zu, indem ich auf meinen Hals deutete: „Er ist noch nicht weg.“ Das Wunder war noch nicht geschehen.
Als ich mit meiner Mutter wieder draußen vor der Kirche stand, war ich sehr enttäuscht und niedergeschlagen. Sie jedoch tröstete mich auf dem Heimweg und redete mir zu, ich solle nur recht fest an meine Heilung glauben.
Und ich wurde gesund. Nach einigen Wochen waren die Beulen weg.
Mutter war der festen Überzeugung, die Gnadenmutter von Mariabronn habe an mir ein Wunder gewirkt, und pflanzte diesen Glauben als ersten Sämling einer lebendigen Frömmigkeit in meine Brust. [163-166]
Der Schutzengel
Mehr als das Wunder der Heilung wirkte jetzt der Zustand der Gesundheit auf mein Leben ein. Mein Körper erholte sich rasch. Meine ungesunde Hautfarbe verlor sich. Ich hätte mich jetzt wieder mit meinen Kameraden tummeln können, aber der Hang zur Eigenbrötelei blieb und verführte mich zum Grübeln und Träumen. Die Krankheit, der Schreck mit den Teufelsmasken, der Tod der kleinen Agnes, die vielen Eindrücke der Wallfahrt, der Glaube an die Heilung durch die Gottesmutter hatten tiefe Spuren gegraben. Wirklichkeit und Überwirklichkeit, Traum und Alltag, Sichtbares und Unsichtbares vermischten sich und schufen eine Welt, in der es wimmelte von Kobolden und Geistern, von Engeln und Teufeln und dem ganzen Schwarm von Hexen, Riesen und Zwergen aus den Erzählungen der alten Fränzel. Wie auf Glatteis tappte ich dahin, immer in der Angst, bald einem Bewohner des Himmels, bald einem aus der Hölle zu begegnen. Verstärkt wurde dieser Geisteszustand durch ein kleines, für mich aber überaus wichtiges Erlebnis.
Wir fuhren in den Wald, um Reisig zu holen, Vater, Mathilde und ich. Da mir das Aufladen zu lange dauerte, streifte ich durch ein dunkles Jungholz, um nach späten Beeren zu suchen. Plötzlich sah ich durch die Stämme der Tannen in der Ferne eine Lichtung, die ganz von Sonnenglanz erfüllt war. Lichtbänder fluteten durch Geäst auf Moosbänke und Büsche. Blaue Teppiche von Vergißmeinnicht breiteten sich zwischen Ruten und Stauden aus und von diesen wiederum hingen Dolden von Früchten in allen Farben. Ich näherte mich voll andächtiger Scheu. Das Licht wurde greller. Die Farbenpracht nahm zu. Eine Menge großer brauner Schmetterlinge gaukelte von Blume zu Blume.
Du bist im Himmel, durchzuckte mich ein Gedanke. Gebannt blieb ich hinter dem Stamm einer Fichte stehen, und da war es mir auf einmal, als fange das Licht an, sich in schwebende Gestalten zu formen, die wie Engel und Elfenwesen von Bus zu Busch tanzten. Ich wagte nicht weiterzugehen und überließ mich bebend vor Erregung dem Zauber der Erscheinung. Wie lange sie gedauert, weiß ich nicht. Sie verschwand, wie sie aufgetaucht war. Meine Phantasie, von der Licht- und Farbenglut berauscht, dichtete sicherlich das meiste hinzu, als ich zuhause meiner Mutter scheu und andächtig das Erlebte schilderte. Sie hinwiederum fand keinen Grund, mir den Glauben auszureden, ich hätte da wirklich in den Himmel hineingesehen.
In diese seelische Wildnis, dieses Hangen und Schweben zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt, trat bald ein lichter Erdenengel und schuf durch sein sanftes Wesen eine vorläufige friedliche Ordnung. Es war meine Kindergartenschwester Monika. [...]
Schwester Monika war schön und groß und ganz in Schwarz gekleidet wie unser Pfarrer Geißelmann. [...] Über Stirn, Kopf und Schulter floß ein langer Schleier mit zwei Flügeln. Weil Schwester Monika so viel würdiger gekleidet war als die Mädchen und Frauen des Dorfes, und weil ihre Art so fromm und gemessen und ernst war, ihr Gesicht aber frisch und sauber und rosig, hielt ich sie lange Zeit für ein höheres, ja heiliges Wesen und sah mit tiefer Ehrfurcht zu ihr auf. Auch sprach sie rein und sagte die Worte deutlich und langsam, ganz anders als die Dorfleute, auch anders als meine Mutter. Nie kam ein grober Ausdruck über ihre Lippen, nie duldete sie, daß wir uns mit bösen Schimpfnamen belegten. Ihr Gemüt war sanft, so sanft wie ihre Hände. Wenn sie uns zeigte, wie man die Hände zum Gebet aneinanderlege, bewunderte ich ihre schmalen, weißen Finger. Alles war besonders an ihr. Auch ihre Stimme klang voll und weich und dunkel wie eine Glocke. [...] Ich konnte mich nicht satt genug sehen an ihrem schönen Gesicht. Kaum hatte ihre sanfte Hand einmal meinen Scheitel gestreichelt, war ich ihr hörig wie ein Hund.
Jetzt ließ ich mich zuhause von Mathilde willig fummeln und striegeln, ließ mir recht sauber die Hände waschen und sah darauf, daß meine Kleider immer in Ordnung waren. Ich wußte, das hatte Schwester Monika gern. Wenn sie mich darob lobte, wenn sie niederkniete und mir die Backen streichelte, verschlug es mir fast den Atem vor Glück und Freude. Alles, mein ganzes Denken war auf einmal erfüllt von Schwester Monika. Schon am Morgen, wenn ich erwachte, war ein Singen und Jubeln in mir: Ich darf in den Kindergarten, ich darf Schwester Monika sehen. Immer war ich der erste an der kleinen Pforte vor der Schwesternwohnung und wartete ungeduldig, bis man mir öffne. Bald sah ich ihr Gesicht am Vorhang, hörte den Schlüssel in der Tür. Da stand sie, kam langsam die Treppe herunter, beide Hände unter dem Skapulier, und wandelte den Kiesweg zwischen Blumen entlang. Ihr Gesicht strahlte. „Ach, da kommt ja schon der kleine Florian“, rief sie jedesmal, gab mir die Hand, beugte sich über mich und lächelte. Manchmal legte sie sogt ihre weiche Wange an die meine. Das war Seligkeit, war der Himmel auf Erden.
Bei Spaziergängen stritt ich darum, an ihrer Hand zu gehen, Ich gehorchte ihr aufs Wort. Ich suchte ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Alle Gebete, die sie uns lehrte, konnte ich als erster auswendig. Und erst, wenn sie erzählte! Sie trug alles so ernst vor, so langsam und eindringlich und machte da. bei predigende Gebärden mit den Händen. Ich lauschte nicht nur andächtig, ich verschlang jedes Wort, so daß ich daheim oft alles haargenau meiner Mutter wiedererzählen konnte. Und sie erzählte lauter fromme Geschichten: vom Jesuskind, von der Gottesmutter, vom heiligen Nikolaus und hauptsächlich vorn Schutzengel. Alles glaubte ich ohne Zaudern, und dieser Glaube war tief und erfüllte meine junge Brust mit Stärke. Es war mein Reich, das Reich meiner vielen Fragen, auf die meine Mutter oft keine Antwort gefunden hatte. Erst Schwester Monika konnte mir Bescheid geben, und ihre Worte rückten in mir all die wirren Phantasiegebilde von Himmel und Hölle und Engeln und Teufeln an den richtigen Ort. [...]
Aus dem Nebel wildschweifender Vorstellungen stieg erstmals jenes uralte Weltbild mit den Mächten des Lichtes und der Finsternis vor mir auf, das seit Jahrtausenden die Menschen im Banne hält. Wenn es auch noch in Gestalt und Größe mehr einer Puppenstube glich, so war doch der Rahmen gestellt, die Grenzen waren gezogen und meine Seele nahm es auf wie ein großes Geschenk und konnte sich jetzt in dieser bildhaften Welt bewegen, ohne fürchten zu müssen, über Teufelsfratzen zu stolpern oder nächtlings Gespenstern zu begegnen, denn – und hierin lag die größte Offenbarung für mich – jedes Kind hat Schutzengel, der ihm zur Seite steht. Immer wieder erzählte uns Schwester Monika von diesem Schutzengel. [...]
Nun geschah es, daß wir mit Schwester Monika einen Spaziergang auf den Kirchberg zum Sportplatz machten und Blumen pflückten. Ein Mädchen, die Margret, warf ein Blumensträußchen mitten auf den Steinweg, und weil der Wind gerade etwas wimmernd um die Bäume strich, sagte Schwester Monika: „Hörst du, Margret, wie dein Schutzengel weint? Heb ja das Sträußchen wieder auf!“
„Das ist doch der Wind!“ rief Margret und ließ die Blumen liegen.
„Florian, heb du sie auf!“ bat Schwester Monika.
Ich tat es sofort und fragte: „Ist das der Wind, der so heult?“
„Nein, nein“, sagte Schwester Monika, „das ist der Margret ihr Schutzengel. Hör nur, wie er weiter weint!“
Ich lauschte, und mit eins durchschauerte es mich bis auf den Grund, und ich wußte bestimmt, daß ein Engel weine. Ich erzählte das Erlebnis meiner Mutter. Sie ließ mich ruhig auf meinem Glauben. „Paß ja auf! Auch bei dir hat er schon oft geheult“, sagte sie, „erst neulich habe ich ihn gehört, wie du in meiner Kammer draußen am Hutzeltopf etwas getan hast.“
Dies Weinen des Schutzengels auf dem Sportplatz ging tiefer in mich ein, als Schwester Monika vielleicht gedacht und gewollt hatte. Ich war und blieb trotz meiner aufkeimenden Leidenschaft für überweltliche Dinge ein Bub, ein Mensch, und oft genug ein Lausbub. Wohl mag es sein, daß verschiedene Boshaftigkeiten unterblieben im Gedanken an den Schmerz, den ich meinem unsichtbaren Kameraden dadurch zufügen würde. Aber ich weiß noch sehr gut, wie ich einmal Zucker aus der Zuckerdose naschte. Erst nahm ich nur einen Brocken und lauschte voll schlechten Gewissens, ob nicht etwas neben mir seufze oder wimmere. Bald naschte ich einen zweiten, einen dritten und vierten. Der Engel weinte nicht. Auch bei Äpfeln und Birnen aus Ottmars Garten weinte er nicht. Ja, nicht einmal, als ich aus Mutters Honigtopf schleckte. Mein Engel, so dachte ich, nimmt es vielleicht nicht so genau. Oder war ex doch bloß der Wind gewesen, der auf dem Sportplatz geweint hatte? Aber Schwester Monika hatte gesagt, es sei ein Schutzengel gewesen, und also mußte es wahr sein.
Vielleicht, so grübelte ich weiter, hat eben doch nicht jedes Kind einen Schutzengel. Wer wollte das wissen, wenn man ihn nicht sehen konnte. Dieser Zweifel nagte lange Zeit an mir und ich hätte allzu gern einen sicheren Beweis für sein Dasein in Händen gehabt.
Also, wenn man Blumen pflückt und wieder wegwirft, dann weinen die Schutzengel. So hatte Schwester Monika gesagt und ich selbst hatte das Weinen mit eigenen Ohren gehört. Als ich einmal ganz allein draußen am Rand einer Wiese stand und ein Sträußlein gepflückt hatte, sagte ich mir, jetzt will ich wissen, ob ich auch einen Schutzengel habe wie die Margret, und warf eine Blume auf den Weg. Wenn er weint, hebe ich sie sofort wieder auf. Ich spitzte die Ohren wie eine Maus. Ich hörte nichts. Ich warf mehrere Blumen weg. Er weinte nicht. Ich warf den ganzen Strauß zu Boden. Wenn ich einen Engel hätte, müßte er doch jetzt schon gehörig schluchzen, dachte ich. Aber nichts geschah. Ich wurde kühner, pflückte einen Arm voll Blumen und streute sie in die schmutzigen Radspuren. Es blieb still. Ich setzte den Fuß auf eine Blume. Ohne Erfolg! Da packte mich die Verzweiflung und ich riß in einem Anfall von Zerstörungswut die Blumen auseinander, zerpflückte sie und horchte wieder mit klopfendem Herzen. Der Engel schwieg. Selbst als ich zum Äußersten schritt und auf den Blumen herumtrampelte, blieb alles still um mich her. Ich war enttäuscht und zweifach entsetzt, einmal über meine Freveltat an den Blumen und vor allem über die niederschmetternde Gewißheit: ich habe keinen Schutzengel. Man hat mich vergessen. Und dies schien mir so gewiß, weil bisher in meinem Leben schon vieles so verquer gegangen war. Die böse Krankheit, der Tod der kleinen Agnes, das Essenmüssen am Katzentischchen, die Lieblosigkeit meiner Geschwister, alles quoll wie ein großes Jammern in meiner Seele hoch.
Als Schwester Monika wieder einmal vom Schutzengel erzählte und uns neue Bildchen von ihm sehen ließ, muß ich sehr trauurig dagesessen haben. Sie fragte mich plötzlich mitten im Erzählen: „Was ist mit dir, Florian? Bist du krank?“ Ich schüttelte den Kopf.
„Was hast du denn?“
Ich schwieg. Sie streichelte meine Haare, da schossen mir auf einmal die Tränen aus den Augen und ich schluchzte verzweifelt: „Alle haben einen Schutzengel, nur ich nicht. Ich hab keinen.“
„Ja, wer sagt denn das? Jetzt komm einmal her, Florian.“
Sie nahm mich in ihre Arme und wischte mir die Tränen ab. „Natürlich hast du einen Schutzengel.“
Ich schüttelte den Kopf: „Nein, ich hab keinen. Ich hab es ausprobiert.“
„Was hast du ausprobiert?“
„Ob – ob – ob ich einen habe oder nicht.“ Ich erzählte ihr die Geschichte mit den Blumen und sie lauschte mit erstaunten Augen.
„Aber so was“, sagte sie und erklärte mir sehr eindringlich, daß die Engel wohl weinen können, wenn auch ganz leise, und nach innen hinein würden sie weinen, in ihr Herz hinein und nicht herausheulen wie die kleinen Kinder. Bestimmt hätte ich einen Schutzengel, und er habe sicher alles gesehen, was mit den Blumen angestellt, und habe gewiß recht heftig geschluchzt. Ich solle daher jetzt umso eifriger zu ihm beten.
Darum also! Nach innen hinein weinen die Engel, deshalb hört man sie nicht. Nur bei arg bösen Kindern höre man sie manchmal wimmern. Aber ganz ganz selten.
Trotzdem, mein Mißtrauen saß mir wie ein Stachel im Herzen und bohrte und bohrte. Ich brauchte einen handgreiflichen Beweis, ob ich wirklich einen Schutzengel habe. Auch der Gedanke, es geht immer ein Engel neben dir her und sieht alles und hört alles, wenn du Zucker stiehlst und an Mutters Honigtopf dir zu schaffen machst, war mir hin und wieder recht peinlich. Da hätte ich gern zu ihm gesagt: bleib einmal hier stehen, an dieser Tür, bis ich wieder herauskomme. Aber das eben konnte man nicht. Das Dasein von Schutzengeln wagte ich nicht zu bezweifeln, denn was Schwester Monika sagte, stand für mich so sicher fest wie mein Vaterhaus oder der Kastanienbaum im Garten. Ich betete jeden Abend sehr gewissenhaft zu ihm und am Morgen, wenn ich aufstand. [...]
Ich sinnierte oft vor mich hin: was tut denn der Schutzengel eigentlich? Er spielt nicht mit uns, er lacht nicht mit uns, er weint nur innen hinein, er schlägt nicht zu, wenn wir böse sind, man sieht ihn nicht, spürt ihn nicht, er spricht nicht – – –. Wie mein Vater oft in verbissenem Kampf sich mit einem Wurzelstock abplagte und nicht eher Ruhe gab, als bis er ihn aus dem Boden gerissen, zerschlagen und zersägt hatte, so rang ich mit dieser ersten großen Frage meines Lebens, suchte sie zu greifen, nicht nur mit meinem Verstand, meiner Phantasie, sondern mit Händen, Augen und Ohren. Himmel und Hölle waren fern. In den Himmel konnte man nicht fliegen und in die Hölle nicht hinuntersteigen. Hier aber hatte Gott ein Geheimnis an unsere Seite gestellt, das unsichtbar neben uns ging, ein Stück Himmel, und doch, wenn man es fassen wollte, griff man ins Leere. Ich fragte meine Mutter, fragte Mathilde, fragte unsere Nachbarin, die alte Seffe, und die Fränzel, und alle bestätigten mir, ich hätte einen Schutzengel neben mir. [...] [167-176]
Neue Wunder
Der Himmel war wolkenlos. Die Sonne schien uns warm auf den Rücken. Die Luft war lau und von den Feldern stiegen schon die ersten Lerchen auf. Mathilde schwatzte von der Mühle, von ihrer Freundin Dore und belehrte mich, die Müllerin sei meine Tante. Mir war der Ausdruck ungewohnt; wir sagten zuhause Base oder ganz einfach Bäs. Ich dachte mir, Tante, das hinge vielleicht mit dem „Lutherisch“ zusammen. „Sagen die Lutherischen Tante?“ fragte ich meine Schwester. „Nein“, erwiderte sie, „aber in der Mühle unten sagt man so, die sind etwas städtisch, mit lutherisch hat das nichts zu tun.“ [...]
Wir kamen in den Wald. Alles war still und feierlich. Zwischen Jungtannen, Gestrüppen und Hecken lagen noch die bauschigen Kissen vereinzelter Schneereste. In den Gräben beiderseits der Straße war Schmelzwasser aufgestaut und bildete oft ganze Seen, aus denen die Stämme der Tannen herausragten. Sonnenbänder flossen durch die Wipfel und warfen große Lichtflecke auf Moospolster und kahle Heidelbeerstauden. Eine Menge Tannenzapfen lagen unter den Bäumen, herabgeschüttelt vorn Föhnsturm, der kurz zuvor wie ein brüllender Stier auf den Winter losgefahren war und mit seinem heißen Schnauben den Schnee verscheucht hatte. Jetzt dampfte alles, reckte sich und dehnte sich wohlig in der Sonne.
Wir bogen in eine schmale Seitenstraße ein, die gemächlich bergab führte. Wohl eine ganze Stunde fuhren wir durch Wald und Wald und wieder Wald. Noch nie war mir der Wald in seiner Größe, seiner Einsamkeit, seiner Stille und Ruhe so nahe gewesen wie an diesem Morgen. Oft fuhren wir lange Strecken unter überhängenden Ästen und mußten uns manchmal tief niederbeugen, um uns vor ihren stacheligen Liebkosungen zu schützen. Dann kamen wir wieder durch Lichtungen mit vielen kreuz und quer herumliegenden nackten Stämmen, zwischen denen die Schnittflächen der Baumstümpfe wie weiße Wundmäler aufleuchteten. Scharfer Duft von Reisig und Harz lag in der Luft. Beinah gruselig wurde es, wenn wir durch halbwüchsigen Jungwald fuhren. Alles Licht war weggesaugt. Aus dunklen Höhlen glotzte uns die Finsternis aus den Lücken zwischen den Stämmen an. Jetzt verstand ich, was Mutter mit ihrer Mahnung sagen wollte, wenn sie Mathilde schalt, man fahre als junges Mädchen nicht allein durch einen so großen Wald. Aber war Mathilde ein furchtsames Mädchen? Schon die Bezeichnung Mädchen paßte ganz und gar nicht zu ihrem Wesen. Furchtlos saß sie neben mir, die Zügel fest in der Hand, und kein Schatten von Ängstlichkeit huschte über ihr Gesicht.
Der Wald ging zu Ende. Die Stämme lichteten sich. „Paß auf, Florian“, sagte Mathilde, „jetzt wirst du etwas sehen, was du noch nie im Leben gesehen hast.“ Nach einer Wegbiegung öffnete sich der Wald wie ein Portal. Eine Lichtflut blendete die Augen. Vor mir tat sich ein Wunder auf, ein kaum zu glaubender Zauber, – die ganze Bergwelt des Schwarzwaldes lag ausgebreitet da. Mathilde hielt an. Ich sprang vom Wagen, eilte auf einen nahen Hügel und stand fassungslos dem Gewaltigen, Großen, Erhabenen gegenüber. Berge, soweit das Auge reichte, ganz nah und überglänzt von der Morgensonne. Täler und Schluchten, Hänge und Halden, übersät von einzelnen Häuschen, die putzig klein an den Bergen klebten. Daß es so was gab! Daß es dies alles schon gegeben hatte, ohne daß ich bisher etwas davon gewußt! Daß die Welt so groß, so unermeßlich groß sein konnte! – – Ich war ganz verwirrt. In meiner Brust schmerzte etwas, als müßte ich gleich losheulen.
Berg an Berg schob sich hintereinander, übereinander, nebeneinander. Alle waren dunkel bewaldet; zu ihren Füßen aber leuchteten die Giebel vieler Dörfer auf.
Und erst dieser weite, weite Himmel, der alle diese Berge umschloß!
Meine Augen tranken und tranken, und je mehr sie tranken, desto mehr wachte ein Durst auf, diese Welt in mich hineinzusaugen, sie an mich zu nehmen und nie mehr loszulassen.
Mathilde rief mich zurück: „Wir müssen weiter, heute abend kannst du es ja nochmals sehen.“
„Ach, warum weiter? Laß mich doch ein Weilchen hier.“
„Nein nein, komm nur“, sagte sie. „Die Berge laufen dir nicht davon.“
Wie schade! Der Weg führte nach wenigen Schritten hinter einen Hang, der alle Aussicht wegnahm. Wir kamen durch das Dorf Bissingen. Die Straße neigte sich mehr und mehr. Nach den letzten Häusern bog sie in eine Schlucht ein, aus der uns ein eisiger Wind entgegenfuhr. Zu beiden Seiten ragten Felswände empor, dunkelrot, naß und nur mit einigen Moosfetzen bekleidet. An der Straße entlang schoß ein Bach, der bald in einen Fluß einmündete. Dieser schien mit seinem donnernden Rauschen und seiner schäumenden Wildheit das gesamte Tal zu beherrschen. In kühnen Sätzen sprang er über breite Felsbänke, zischend, sprühend und aufleuchtend in gischtigen Schaumflocken. Bald teilte er sich in mehrere Arme, als wollte er sagen: all dies gehört mir, und drückte die Straße dicht an die Felswand; bald vereinigten sich die Arme wieder und bildeten ein tiefes Bett aus Stein und Geröll, wo er sich drohend und schnaufend dahinwälzte; bald staute er sich auf zu einem See, als sammle er alle Kräfte zu einem Angriff, dann stürzte er in einem jähen Sprung brüllend von einer Steinwand herab.
So etwas an wilden Wassern hatte ich noch nie gesehen. Wie zahm waren dagegen die Bäche meiner Heimat, der Rotbach, der Seebach, die Birkach. Frommen Kindern gleich ließen sie sich durch die Wiesen leiten. Aber dieser da war ein polternder Waldschratt, der keinen Zwang duldete. Er zerriß die Wiesen zu Fetzen. Er sägte Felsen mitten durch. Er zog Bäume in sein Bett hinein. Er spielte nicht mit Kieseln, sondern mit mannshohen Blöcken. Er schrie und tobte, zappelte und gurgelte, schäumte in wilden Strudeln und tanzte in tollen Wirbeln. Es klang wie eine Beleidigung, als Mathilde mir sagte, das sei der Mühlbach. [...]
Während des Essens blickte ich mich schon freier in der Stube um. Etwas fiel mir auf und trotzdem suchte ich vergebens danach, was es sei. Alles war so ganz anders als bei uns zuhause. Meine Schwester deutete auf eine Lampe, die an Schnüren über dem Tische hing. „Das ist elektrisches Licht“, sagte sie. Wohl hatte ich von meinem Bruder Paul schon sagen hören, es gebe Lampen, die man mit einem Druck auf einen Knopf anzünden und auslöschen könne. Als die Tochter wieder hereinkam, bat Mathilde, sie möchte es mir einmal zeigen. Sie griff nach einer schwarzen Kapsel an der Stubentür. Ich hörte ein Knacken, und im gleichen Augenblick sah ich in einer durchsichtigen Glaskugel etwas Zickzackartiges aufleuchten. „Wir machen das Licht selbst“, erklärte mir das Mädchen, „Vater hat es vor einem Jahr eingerichtet.“ [...]
Georg gab mir einen Wink. Die Müllerin steckte mir noch zwei Äpfel in die Tasche und mahnte ihren Jungen, besonders am Mühlbach unten vorsichtig zu sein. Georg stieg mit mir eine dunkle Treppe hinunter und suchte an der Wand. Ich hörte ein Knacken und plötzlich war alles taghell erleuchtet. Als er mein Staunen sah, fragte er, ob ich das nicht kenne, und drehte das Licht noch einigemal auf und zu. Darauf wurde ich durch einen langen Gang geführt, an dessen Wänden zu beiden Seiten eine Menge Säcke standen. Das Dröhnen, das bisher nur aus der Ferne zu hören gewesen war, wurde immer stärker und stärker. Als Georg eine Tür öffnete, wurde es so laut, daß er schreien mußte, um sich verständlich zu machen. Ein Geknatter, Gepolter und taktmäßiges Klappern erfüllte die Luft. Wolken von Mehlstaub wirbelten durch wirres Balkenwerk, zwischen dem eine Fülle sonderbarer Maschinen und Apparaturen, Treibriemen und Drehscheiben sich in zitternder Bewegung befanden. Georg versuchte, mir die verschiedenen Gänge zu erklären, durch die das Getreide hindurch mußte, ehe es zwischen den Mühlsteinen zu Mehl zerrieben wurde. Aber ich verstand nichts. Seine Stimme war zu schwach, sie kam gegen den Lärm nicht auf. Ein ähnliches Gefühl wie beim Anblick der Berge und des Flusses beschlich mich, zugleich ein kleiner Neid auf meinen Kameraden, daß er diese Herrlichkeit täglich erleben durfte. Er nahm mich bei der Hand, führte mich treppauf, treppab, ließ mich in die Mulden hineinsehen, wo das Mehl gesiebt und gebeutelt wird. [...] [181-190]
Die neue Zeit
Mutter sah über solche Ausbrüche meist hinweg mit einem: „O ihr Männer! Ihr seid doppelt so schlimm wie Kinder.“ Sie war versöhnlich, nicht etwa um des häuslichen Friedens willen, sie konnte einfach keine bösen, nachtragenden Gedanken in ihrer Seele brauchen. Mir dagegen war dies Wesen meines Vaters unverständlich. Da ich bei ihm keinerlei Anhalt für meine Liebe fand, mit ihm über nichts reden konnte, nie Antwort auf die vielen mich bedrängenden Fragen bekam, schloß ich mich in diesen Jahren ganz meiner Mutter an. Es war nicht der Drang nach Zärtlichkeit und ein Haschen nach Gegenliebe. Mutter war wenig zärtlich, süßlich oder weichherzig schon gar nicht. Ihr Verstand durchkreuzte immerfort ihre Gefühle und machte sie mißtrauisch allen rein menschlichen Regungen gegenüber. Auch ihre Frömmigkeit war nicht weich, und nichts haßte sie mehr als Scheinheiligkeit und betselige Frömmelei. Dagegen in Dingen der Sittlichkeit war sie fast engherzig. Mit Falkenaugen wachte sie über der Reinheit ihrer Kinder. Das gab oft harte Auseinandersetzungen, bei denen ihr unbeugsamer Wille sie immer wieder zu grundlosen Anwürfen hinreißen ließ. Sie stand so fremd in der Wirklichkeit, daß schon ein harmloser Postkartenengruß eines Mädchens an meine Brüder genügte, in ihr eine Lohe der Angst und zitternden Erregung zu entfachen.
Aber hinter der strengen Frömmigkeit und Sittlichkeit tat sich mir bald, wie eine blühende Wiese, ein Reich auf von so zauberhafter Weite, Schönheit und Strahlenfülle, daß ich mit der Zeit mehr und mehr in seinen Bann geriet. Es war das Reich des Religiösen schlechthin, das Reich der Gottesfreiheit. Hier ergingen sich seltsame Gedanken und Gefühle wie Wesen von einem andern Stern. Hier lebte etwas, ein Erbe der Menton, ein geisterndes Suchen und Finden, Sichvereinen und Lösen von Vorstellungen, die ihr nicht aus der engen dörflichen Glaubenswelt zugewachsen waren. Von hier kamen mir auch die ersten tiefen Gedanken über die Dinge, die rätselhaften Erscheinungsformen.
Ich hatte die beobachtenden Augen meines Vaters. Nichts entging mir. Aber nichts kann den Verstand eines Kindes mehr verwirren als die Überfülle der Dinge, die täglich wie brandende Wogen sich am Herzen aufstauen, empfunden werden wollen, um durch die Empfindung hindurch als Wissen in den Verstand einzugehen.
Es blühen Tausende von Blumen. Jede ist anders, jede hat andere Färbung, eine andere Gestalt. Da steht die Mauer des Tannenwaldes und dahinter Stämme und Stämme und wieder Stämme, aufragend, sich wiegend im Wind, übergroß und kaum zu fassen in solcher Unzahl. Mitten im Dunkel aber brodelt es in Waldlichtungen, auf Hecken, Pilzen und Blütenschirmen, von Fliegen, Motten, Käfern, Wanzen in allen Farben. Betörende Düfte steigen auf und Dolden von Beeren hängen an Büschen. Da stößt der Fuß an einen Ameisenhaufen. Ein schwarzes, schreckenerregendes Gewimmel; unfaßbar, was diese Tiere tun, wohin sie streben, warum sie leben. Und Bäche rieseln durch die Wiesen, schwellen an, schwellen ab, versiegen und sind wieder da, vereinigen sich, rinnen weiter im Fluß, und der Fluß verschwindet wieder im Wald. Neben dem Fluß, zwischen Erlengebüsch und Weiden, stehen die dunklen Tümpel, in denen es wimmelt von kleinen pfeilschnellen Fischen und schwarzen Kaulquappenschwärmen. Am Ufer zittern Ballen von Froschlaich. Auf dem Grund, unter Wasser, schlängeln sich Egel, kriechen Molche und Schnecken mit seltsam gewundenen und gebänderten Gehäusen. über dem Wasserspiegel blitzen die glasblauen Flügel der Libellen. Dann wieder die Vögel, die in der Luft schweben dürfen, große, kreisende Bussarde und Gabelweihe, Sperber und Habichte; oder huschige Meisen und winzige Zaunkönige, ganze Ketten von Staren auf den Telephondrähten, die schwatzend mit den Flügeln schlagen. Oder sieh diesen Schwalben zu, wie sie ihre Nester bauen, die Jungen füttern und sich blitzschnell über Bäume und Häuser werfen. All das heischt Antwort, alles rührt Fragen auf, will begriffen sein, regt die Seele an zu tausend phantastischen Bildern und Träumen.
Da fielen mir dann manches Mal, wenn ich den Reichtum kaum mehr fassen konnte, Worte aus der Mutterseele zu, die ich wie Lichter hinter den Dingen empfand, Lichter, die mit ihren Strahlen sie zu großen Einheiten wie zu Blumensträußen zusammenbanden. Es waren Redewendungen, Spruchweisheiten, die nicht eine Erklärung suchten oder geben wollten, sondern die, mit andachtvoller Scheu gesagt, in mir gleiche Andacht erweckten. So konnte Mutter immer, wenn wir vom Felde heimkehrend vom Klingenbühl aus das unabsehbare dunkle Meer der Wälder, das bis an unser Dorf sich aus der Tiefe daherwälzte, staunend betrachteten, den Arm um mich legen und sagen: „Kind, die Welt ist Gottes Angesicht.“ Sie deutete das Bild nicht aus, sie überließ es mir, die Perle dieses Wortes sinnend zu hegen. Es kam wieder und wieder, und oft wußte ich schon im voraus, jetzt sagt sie das von Gottes Angesicht.
Ich aber grübelte darüber nach und dachte mir es aus, die Tausende von Blumenaugen, die düsteren Brauen der Wälder, die dumpfe Stimme des Donners, das Atmen der Winde, das Zornblitzen der Gewitter, und suchte in diesem Gesicht zu lesen.
„Wer Gott im Herzen trägt, begegnet ihm auf allen Wegen.“ Auch dieses Wort wiederholte sich bei bestimmten Anlässen Wie der Gongschlag einer Uhr. Mutter war viel zu sinnenfroh, um im rein Gedanklichen ihr Genügen zu finden. Wenn ein abgerissener Lump und Säufer an die Tür pochte und um eine milde Gabe bat, brauchte sie nie einen Widerwillen zu überwinden, so wenig wie ein Arzt, der ein ekles Geschwür heilt. Es war ihr zutiefst gewiß, Gott hat diesen Menschen geschickt. Sie führte ihn an den Tisch, gab ihm zu essen, setzte sich neben ihn, fragte dies und das und war nachher immer selig, wenn man sie ausschalt, wie sie nur einen solchen Stromer habe einlassen können. „Was wollt ihr denn“, sagte sie, „es ist Kunst, einem schönen armen Mädchen zu helfen. Aber dieser da weiß, daß er bei mir ein gutes Wort bekommt, und deshalb freut es mich, wenn er bei mir anklopft. Hier klopft er an“, und sie deutete auf ihre Brust. Und dann kam es, das Wort: „Wer Gott im Herzen trägt, begegnet ihm auf allen Wegen.“
Frömmigkeit ist eine Kunst wie Weisheit. Sie ist ein Geschenk und nicht nur Herzensübung. Mutter verstand sich auf die Kunst, fromm zu sein. Brachte ich ihr, was sie immer liebte und wofür sie mich stets mit einem kleinen Backenstreich belohnte, Blumen mit nach Hause, holte sie sofort eine Vase, stellte den Strauß auf den Tisch, betrachtete ihn aus der Ferne und sagte: „Kind, schau, ist das nicht ein Gebet?“
Für sie war die ganze Natur ein Gebet. Besonders Getreidefelder vor der Reife waren ihr Gebete des Herrn. Drückte der Wind sie zu wogender Bewegung, redete sie von den Händen Gottes, welche über die Saaten streichen. Betrachtete sie eine Handvoll Ähren, suchte ihr Geist sofort die Brücke zum Menschlichen, zum Göttlichen. „Der Mensch ist wie eine Ähre in der Hand Gottes, je voller sie ist, desto tiefer neigt sie sich.“
Wie in der Musik ein Motiv anklingt, sich verändert und in wechselnden Verwandlungen durch alle Instrumente eines Orchesters hindurchzieht, so war ihr das ganze Sein nur der immer wiederkehrende Wohllaut einer aus Gott quellenden großen Wirklichkeit. Woher hatte sie, die einfache Bauersfrau, ihre Gottesweisheit? Wer nicht um das Geheimnis einer wahren, schenkenden Frömmigkeit weiß, wird es nie begreifen. Aus Büchern kam sie ihr nicht. Mutter las wenig. Aber wenn sie irgendwo ein Goldkorn gefunden hatte, sei es in einer Predigt, einem Gespräch, einem Zeitungsroman, behielt sie es, sann darüber nach und liebte die kleine Weisheit so lange und beinah schwärmerisch, bis sie ihr zur großen Weisheit, zur Offenbarung wurde.
Ich brauchte keinen Platon zu lesen, um zu erfahren, daß die ewigen Ideen in uns sich in der Wirklichkeit außer uns als Wahrheit, Schönheit, Güte und Liebe spiegeln. Mutter sagte mir das in schlichten Worten, als ich sie einmal fragte: „Warum ist die Erde so schön und der Himmel und die Sonne und die Wolken? Warum ist das alles manchmal so schön?“ – „Weil deine Seele schön ist, Kind. Der böse Mensch sieht nur das Böse in der Welt, der gute nur das Gute.“ [...]
Aber die Welt ist eben nicht nur Gottes Angesicht, ist nicht immer schön und selten gut, besonders die Menschenwelt nicht. Darum lebte Mutter so schwer und unpraktisch und quälte sich oft so furchtbar in ihren Gewissensskrupeln. Sie wollte gut sein, rein und heilig sein, sie sah die Wege und wußte um die Quellen Gottes und rang verzweifelt gegen die niederziehenden Mächte der Erde. Einmal sah ich sie am Herdfeuer stehen, in seine Glut starren und tonlos murmeln: „So brennt alles alles weg, das Leben und die Liebe und die Unschuld, Kind! Alles frißt die Zeit“, und dann hob sie die Arme und rief aus: „O, Ich wollte, alles bliebe stille stehen. Ich möchte die Welt anhalten und aufhalten, wenigstens für einen Augenblick, und auch euch Kinder möchte ich anhalten. Aber – –“ und ihr Kopf neigte sich über die Flamme – „aber sie frißt alles weg, die Zeit.“ Es klang wie der Wehlaut eines Engels, der zum Leben verdammt ist.
Ja, sie wollte immer anhalten und aufhalten. Schon das bloße Wachstum ihrer Kinder erfüllte sie mit Angst und Bangen. „Mein Gott!“ rief sie oftmals aus, „ihr werdet groß und immer größer, und eines Tages ist es so weit, dann kommt das Tier, die Sünde, und frißt alles Fromme weg, was ich an euch hingebracht habe. Dann müßt ihr büßen und im Staub kriechen, müßt Kinder kriegen und all das wieder mitmachen, was ich mitgemacht habe. Und ich habe immer gedacht, es sei genug wenn ich es für euch getan habe. Aber jedes will es wieder tun und die gleichen Fehler machen. O Kinder. Ich will das nicht. Wenn ihr nur bleiben könntet, wie ihr jetzt seid. Es wird nicht besser später, glaubt es mir. Man wird schlechter, wenn man älter wird. Die Sünden kommen, und alle Freuden muß man so bitter bezahlen, dreifach, zehnfach, hundertfach.“ [...] [245-250]
Mutter liebte das Leben und wollte es in edler Form genießen. Diese Form, angefangen beim sauberen Tuch, das sie als Mentontochter über alles schätzte, über den besinnlichen Gang zur Kirche, über die langsam sich öffnende Blüte einer Liebe, den Duft hingebender Frömmigkeit, bis zu der größten Form, dort, wo der Mensch in seinem körperlichen Sein auslischt und nur noch lauscht und schaut und sich an das Wunder der Gottheit verliert, bis sie ihn segnet mit Glaube und Zuversicht, diese Form vermißte sie bei ihren Kindern.
Einmal warf sie meinen Brüdern ins Gesicht: „Ihr freßt das Leben, wie eine Kuh Krautplatschen hineinfrißt.“
Sie freilich schüttelten die Köpfe. Was wollte sie denn? Was hatte sie denn immer an ihnen auszusetzen? Sie taten doch nur, was recht war, was andere auch taten.
Aber Mutters Gang schon, dieses zierlich langsame Wandeln, als ginge sie achtsam durch Blumen, hätte sie aufklären sollen, was sie meinte. Langsam sollen sie gehen. Wer langsam geht, er allein kann wahrhaft sehen, hören und denken, er kann Gottes Atem vernehmen.
Wie ferne schon lag uns allen diese Weisheit. Wußte sie, daß sie sich mit ihrer verlorenen Stimme gegen den Aufbruch einer neuen Zeit stellte?
Meine Brüder brachten sie von der Stadt herauf. Sie wußten um das Geheimnis der Zukunft. Schnelligkeit, Wendigkeit, Hast, rollende Räder, Maschinen, Motoren, das war die Neuzeit. Sie zeigten eine von Jahr zu Jahr wachsende Abneigung gegen den Kirchenbesuch, gegen Beichten und Beten, gegen althergebrachte Sitten und Gebräuche. Sie schlangen abends das Essen hinunter, warteten am Ende nicht auf das Dankgebet. Da wurde rasiert und pomadisiert und das Haar aufgebürstet. Da mußte man in die Singstunde, in die Turnstunde, zur Fahrradübung.
Am Sonntag hieß es: los, los! Ist das Essen noch nicht fertig? Die Fahrräder standen schon bereit, irgendwo fand ein Sängerfest, Radfahrrennen, eine Fahnenweihe statt, damit waren verbunden: Wirtshäuser, Mädchen, Tanzabende.
Illustrierte Zeitungen und Zeitschriften hielten ihren Einzug. Was sie brachten, war harmlos, doch vor den ängstlichen, um die seelische Reinerhaltung ihrer Kinder besorgten Blicken meiner Mutter konnten sie nicht bestehen. Es gab Auseinandersetzungen oft Abend für Abend. Rede und Gegenrede wühlten Worte auf, die wie Dolche in ein Mutterherz dringen mußten. Paul versuchte durch Geschenke, kleine Leckereien, durch Spielzeuge für uns Kinder immer wieder zu versöhnen.
Heinrich dagegen schüttelte einfach alles rundweg ab. Schon wenn Mutter mahnend den Finger hob, brach er los. „Ich weiß!“ rief er. „Betet eure alte Litanei von mir aus dem Ofen vor!“
Eines Tages schien es, als wolle er sich einfach aus der Familie losreißen, um frei seinen Weg in die Welt zu gehen. Es war wohl eine der schwersten Prüfungen für meine Mutter und endigte doch wieder der dort, wo sie begonnen, in dem gänzlichen Mißverstehen seiner Art. Es war beinah lächerlich, wie sehr sich Mutter und ihr ältester Sohn zeitlebens mißverstanden, ohne daß eines vom andern gelassen hätte.
Es war ein Neujahrsmorgen. Mutter pflegte jedem Kind zum neuen Jahr in einer feierlich innigen Weise alles Gute zu wünschen. Den Großen schüttelte sie die Hand, sah ihnen in die Augen und sagte jedesmal am Schluß: „Und gelt, bleib mir brav.“ Wir Kleinen bekamen einen zärtlichen Kuß mit einer festen Umarmung. Nur zwei Küsse gab sie im Jahr: einen zum Namenstag und einen zu Neujahr.
Diesmal waren meine Brüder noch gar nicht zuhause. Sie hatten, was niemand ihnen verdenken konnte, Silvester gefeiert, hatten geschossen, gesoffen und mit andern im Dorf herumkrakeelt; in der Frühe kamen sie in einem wüsten Aufzug heim. Wir saßen schon beim Morgenkaffee, da flog die Haustür polternd auf, Radaumusik gellte im Flur. Die Stubentür wurde aufgestoßen. Heinrich mit einer Ziehharmonika um den Hals torkelte herein, hinter ihm Paul und ein Schwarm betrunkener Kameraden mit schiefen Hüten und schiefen Beinen.
Dann ging alles ganz rasch. Mutter, die kleine Frau, sprang vom Stuhl hoch, der Stuhl wetterte zu Boden, mit einem Blick überschaute sie die Lage, eine dunkle Röte stand in ihrem Gesicht, und ehe es sich meine Herren Brüder versahen, hatte jeder ein Paar Backenschellen im Gesicht. Die Ziehharmonika flog in einen Winkel, Mutter faßte die Tür. „Hinaus mit euch!“ rief sie den Fremden zu. Die zogen die Köpfe zwischen die Schulternn, schlichen davon wie ertappte Diebe. „Und mit euch beiden!“ schrie Mutter, „ mit euch spreche ich, wenn ihr eure Räusche ausgeschlafen habt. Fort ins Bett!“ Sie schob sie zur Tür hinaus und warf sie krachend ins Schloß.
Am Abend gab es eine Strafpredigt, die selbst unserm Pfarrer Geißelmann alle Ehre gemacht hätte. Paul nahm sie hin, schweigend wie immer. Aber Heinrich begehrte auf: „Mit vierundzwanzig Jahren soll ich mich behandeln lassen wie ein Schulbub.“ Er schere sich einen Dreck um das, was sie sage und denke. Wer denn eigentlich das Geld ins Haus bringe, sie mit ihrem Weihwasser oder er mit seiner Arbeit. Wenn das keinen Rausch vertrage, werfe er den Bettel hin und gehe.
„Dann mußt eben gehen“, sagte Mutter, „wenn es dir bei uns nicht mehr gefällt. Ich halte dich nicht und Vater auch nicht.“
„So“, sagte Heinrich, „das wollte ich nur wissen jetzt weiß ich, was ich tue. Zehn Jahre habe ich geschuftet für euch alle. Das ist nun der Dank. Eine Ohrfeige und einen Tritt in den Hintern.“
„Heinrich! Heinrich!“ Mutter wollte noch etwas sagen. Aber er warf die Tür vor ihr zu und ging.
Am andern Morgen war sein Bett leer. Seine Sonntagskleider, seine Wäsche waren fort. Keinen Gruß, keinen Zettel, nichts hatte er hinterlassen. Auch Paul wußte nur, daß er gegangen war. Man brauche ihn nicht zu suchen, finden würde ihn doch niemand, das habe er noch gesagt. Vielleicht wußte Paul mehr und sagte es nicht.
Es war ein trübseliger Jahresanfang. Heinrich blieb in folgenden Nacht ebenfalls aus. Es vergingen drei Tage, fünf Tage, er kam nicht. Das einzige, was wir erfahren konnten, war, er sei mit einem Koffer am Morgen mit dem ersten Postomnibus in Richtung der Kreisstadt abgereist.
Mutter war in diesen Tagen in einer Erregung, die nichts von Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit an sich hatte. Alles an ihr war ein einziges Feuer der Empörung, nicht nur gegen ihr Kind, das ihr den Fehdehandschuh hingeworfen hatte, sondern mehr noch gegen den Geist, aus dem heraus dies geschehen war. Sie besaß die feine Witterung für die tieferen Zusammenhänge. „Das sind die Fabriken mit ihrem neuen Geist“, klagte sie. „Da heißt es gleich: Ich kann tun, was ich will. Ich verdiene mein eigen Geld. Nichts ist mehr heilig und geweiht. Da gilt keine Familie mehr, kein Pfarrer, kein Gotteshaus, keine Mutterliebe. Das sind die Bücher und Zeitungen, in denen geschrieben steht: Es gibt keinen Gott und keinen Himmel und keine Seligkeit.“ Und wenn sie in ihrer Entrüstung klagte, konnte sie plötzlich in einer bebenden Ekstase die Faust erheben und wie zum Schlage ausholend sie einige Male niederfahren lassen, als befände sich ein unsichtbares Schwert in ihrer Hand: „Der Herr soll sie verfluchen mit ihren Maschinen und Motoren, wenn sie die Kinder gegen die Eltern aufreizen, daß sie ihnen Sorge und Liebe zurück ins Angesicht werfen. Zerschmettern soll der Herr ihre Geldmühlen und Schandhäuser, daß kein Stein auf dem andern bleibt.“
Was tat Vater? Er lächelte nicht, zuckte nur mit den Schultern, tat weder Rede noch Widerrede. Er sagte nichts, ging seiner Arbeit nach und wehrte sich höchstens, wenn Mutter im heißen Zorn ihm Vorwürfe machte. In diesen Tagen kam das schier täglich vor. Mutter versuchte, Vaters Autorität aufzurufen, ihn anzustacheln: „Du bist schuld. Du läßt den Kindern alles durchgehen. Du solltest hinstehen. Wenn ich deine Kraft hätte, da sollte mir eines wagen, einfach davonzulaufen. Warum stehst du nicht hin? Du bist doch Mann und Vater. Was tust du jetzt? Heinrich ist fort. Jetzt mach etwas. Jetzt ist’s zu spät.“
Vater sagte lange nichts. Wenn er sein inneres Gleichgewicht hatte, war er nicht aus der Ruhe zu bringen. Er sagte nur: „So einfach ist das nicht mit dem Davonlaufen. Der kommt bald wieder.“
Diese selbstsichere Gewißheit regte Mutter noch mehr auf. „Nein, Ferdinand, ich sag dir, der kommt nicht mehr. Das vergißt er mir nie im Leben, daß ich ihn ins Gesicht geschlagen habe.“
Aber Vater sagte ganz gelassen, ganz nebensächlich, als handle es sich um eine verlaufene Katze: „Der kommt wieder. Ich kenne meine Kinder besser als du.“
Wenn Vater in Mutters Aufregung hinein so etwas sagte, so etwas wie „meine Kinder“, da wurde Mutter geradezu bös und ungerecht. Da konnte sie ganz aus dem Häuschen fahren. Da fielen dann die bissigen Worte kollerweise aus ihrem Mund: „ Ja, ja, deine Kinder. Es sind immer deine Kinder. Dir aus Gesicht und Seele geschnitten. Aber ich, ich muß sie aufziehen, ich muß mich mit ihnen herumplagen, ich muß sie zum Guten anhalten, muß ihnen predigen, muß vor sie hinstehen und ihren Zorn auf mich laden. Du sagst nichts, du läßt sie nur laufen. Dir ist alles gleich, ob sie in der Welt herumirren, wie jetzt dieser Heinrich. Fünf Nächte war er nicht da. Wo hat er geschlafen? Wo hat er gegessen? Mit welchen Saufbrüdern hat er sich herumgetrieben und wahrscheinlich noch mit diesen gottverdammten Fabrikschicksen. Heiliger Himmel, und du, der Vater sitzt da und sagt zufrieden: ,Er kommt wieder. Ich kenne meine Kinder.’ Aber wie er wiederkommen wird, verdorben an und Seele, darnach fragst du nicht.“
Wenn ich als Kind solchen hitzigen Gesprächen zuhörte, ließ ich mich von Mutters Wortgewalt und schnellem Denken immer blenden, gab ihr im stillen recht und teilte ihre Ängste und Sorgen. Sie grübelte, überlegte, warf Gründe und Gegengründe hurtig wie Stricknadeln hin und her und kam so zu ihren Schlüssen. Dabei bemerkte ich gar nicht, wie sie sich verrannte wie sie Teufel an die Wand malte, über die Vater einfach lachte, wie sie im Raum der bloßen Vernunft sich die grauenhaftesten Bilder und Vorstellungen von einem verlorenen Sohn zusammenreimte, einem Sohn, der sein Geld mit Dirnen verpraßt und zuletzt froh ist, wenn er mit den Säuen an einem Trog den Hunger stillen darf. Sie war viel zu unkörperlich veranlagt, um noch jenen Instinkt für das Mögliche zu besitzen. Vater dagegen war in solchen Dingen so sicher wie ein Tier. Da gab es für ihn gar keinen Zweifel. Er stand auf seiten seiner Kinder und brachte ihnen jenes Maß von Vertrauen entgegen, das er für sein Tun in sich selbst setzte. Er sagte einfach: „Heinrich kommt wieder.“ Und als Mutter ihn beinah beleidigend fragte: „Wie willst du mit deiner Gescheitheit das denn wissen?“ antwortete er: „Weil er Bäume im Garten hat. Man läßt hundert Obstbäume, die man selbst großgezogen hat, nicht im Stich.“
Dieser Glaube an selbstgepflanzte Wurzeln der Liebe zum Lebendigen ging Mutter nicht ein, weil sie als Kind einer Kaufmannsfamilie solche erdhaften Bindungen unterschätzte.
Wieder vergingen Tage des Wartens. Die Woche war um. Heinrich kam nicht, ließ nichts von sich hören. Mutter schien Recht zu behalten. Abends saß sie vornübergebeugt, die Hände auf dem Rücken, auf der Ofenbank, wippte mit den Schuhen auf und ab und starrte grübelnd auf den Fußboden. Aus dieser Haltung konnte sie jählings hochfahren und vor Vater hintreten. „Wenn er aber jetzt wiederkommt, der Heinrich, dann mußt du, Ferdinand, einmal hinter ihn steigen. Dann mußt du ihm die Meinung sagen. Das verlange ich von dir. Du bist der Mann und Herr im Haus. Von mir nimmt er schon lange nichts mehr an.“
Vater, in seine Zeitung vertieft, wurde immer ungehalten, wenn man ihm sein Abendstündchen störte. „Laß mich endlich mal in Ruhe und warte ab. Und was soll ich ihm denn sagen? Ich habe ihn nicht ins Gesicht geschlagen. Ich nörgle nicht an ihm herum. Mir ist er recht, und wenn er einmal an Silvester sich einen Rausch antrinkt, Herrschaft, ist das denn ein Verbrechen?“
Nach etwa zehn Tagen erhielten wir einen Brief von Heinrich. Ich kann ihn heute noch auswendig Wort für Wort niederschreiben, weil wir ihn wohl an die hundertmal uns gegenseitig vorlasen und an seinem Inhalt wie an einem Rätsel herumstudierten. Dabei war alles klar, einfach, vernünftig. Wir aber, besonders Mutter, hatten uns bereits in den abenteuerlichsten Vermutungen herumgehetzt, so daß es uns jetzt mit eins schwer fiel, die durchgegangenen Rosse der Phantasie einzufangen und wieder an die Deichsel der Vernunft anzulegen. Heinrich schrieb: „Liebe Eltern und Geschwister. Ich befinde mich in der chirurgischen Klinik in Tübingen und habe meinen Bruch operieren lassen. Einmal mußte es doch sein. Die Operation ist gut verlaufen. Besuchen braucht mich niemand, das würde nur Geld kosten, zudem wäre ich kaum anzutreffen, weil ich bei diesem schönen Wetter alle Baumschulen in der Umgebung besuchen und die Bestellungen fürs Frühjahr gleich vornehmen will. Und weil ich gerade hier bin, soll Mutter mir ein Paar ihrer alten ausgetretenen Schuhe schicken. Ich will in der orthopädischen Abteilung einen Leisten für ihren herben Fuß anfertigen lassen und gleich ein neues Paar in Auftrag geben. Das geht alles in einem. Es grüßt Euch herzlich Euer Sohn und Bruder Heinrich.“
Mutter vergoß Tränen über diesen Brief. Sie trug ihn in der Tasche mit sich herum. Sie las ihn, wann immer sie Zeit hatte, in der Küche, im Stall, morgens, wenn sie aufstand, und bevor sie ins Bett ging. Sie war plötzlich ganz klein, ganz kindlich, sie wich nicht mehr von Vaters Seite. „Verstehst du das, Ferdinand? Kommst du aus diesem Kind noch draus? Der Leisten, die neuen Schuhe, und an meinen Fuß hat er gedacht. Das ist doch nicht schlimm mit meinem Fuß. Der Knöchel ist geschwollen und da drückt mich eben jeder Schuh. Aber daß er daran gedacht hat. Verstehst du das?“
„Was du nur hast“, sagte mein Vater. „Laß ihn doch in Ruhe. Der findet seinen Weg.“
„Ja, ja“, versicherte Mutter, „ich laß ihn jetzt. Er ist nicht schlecht, oder doch?“ Sie suchte immer in dem Brief herum. Was suchte sie wohl? Ihren Heinrich suchte sie, ihr entlaufenes Kind, das so gar nicht zu ihren biblischen Vorstellungen von einem verlorenen Sohn paßte. Sie dachte Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe durch, immer von neuem und jedesmal mit tropfenden Augen, bis Mathilde über diesem Tun nervös wurde und ihr den Brief aus der Hand riß. „Ich möchte nur wissen, was es da noch zu brüten gibt. Das ist doch ganz klar.“
Mutter seufzte: „Das verstehst du nicht. Das kannst du nicht verstehen. Ich suche etwas und kann es nicht finden. Ein Wort, nur ein Wort, ein warmes Wort. Das ist alles so kalt und geschäftsmäßig. Und doch steckt es drin, das Wort. Ich weiß nur nicht. Aber in den Schuhen, da steckt es doch drin. Oder nicht., Mathilde?“
„Was soll da viel drinstecken?“
„Mein Kind, Mathilde, mein Kind, mein Heinrich.“
Mathilde hielt das Schreiben hoch in die Luft, schlug mit dem Handrücken gegen das Papier. „Natürlich steckt er da drin. Das ist er doch, Wort für Wort. Das ist doch der Heiner, wie er leibt und lebt. jetzt hat er einmal vierzehn Tage in der Fabrik aussetzen müssen. Das muß ausgenützt werden. Bei ihm muß immer alles ausgenützt werden. Da wird ein Rausch gesoffen, wird Krach gemacht, man läuft davon, aber auch das Davonlaufen muß ausgenützt werden. Also läßt man sich operieren, besichtigt Baumschulen, bestellt Obstbäume, läßt einen Leisten für Mutters Fuß anfertigen, weil man gerade in Tübingen ist. Die Schuhe werden gleich bestellt, man kann so das Porto sparen. Besuchen braucht man ihn nicht, es würde nur Geld kosten. Das ist doch Heiner. Immer verrückt, interessiert, praktisch, immer schnell, schnell und aufs Geld aus wie der Teufel auf Seele.“
Mutter war am Rande. Vor diesem Scharfblick kapitulierte ihre ganze Klugheit. Kleinlaut, demütig, ganz in Freude sich auflösend fragte sie: „Ja meinst du? Vielleicht hast du Recht. Ja, aber die Ohrfeige und das Davonlaufen und alles, was er mir in diesen acht Tagen angetan hat?“
„Ach“, sagte Mathilde, „das hat er alles schon wieder vergessen. Der rennt ja dauernd sich selbst davon.“
„Wie du das nur sagst. So ohne Gefühl, und doch hast du Recht. Ich grüble mir das Hirn aus und find es nicht.“ Jetzt streicht sie über die Schürze, die kleine Mutter, glättet die Falten über ihren Knieen, wirft den Kopf zurück und ist wieder ganz sie selbst, lebhaft, spöttelnd, hitzig. „Du hast es leicht. Du kennst ihn, weil du genau so bist. Alle seid ihr so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, einfach so heidnisch wie ,er’.“ Damit meinte sie Vater.
Es war aber kein Heidentum, was Mutter an ihren Kindern tadelte. Es war der neue Geist. Man ging noch zur Kirche, ging noch zu den Sakramenten, aber der heilige Bann der Kirche war gebrochen. Man sagte vom Ortspfarrer noch „der Herr“, aber er war kein Herr mehr. Er waltete nicht mehr als Seelsorger, der den ganzen Umkreis seelischer Wirksamkeit beherrschte und in Ordnung hielt. Der Geist war aus dem Banne ausgebrochen, nur das Gefühl war noch zurückgeblieben. – –
Dieser Geist der neuen Zeit rührte bald auch an unser Hausheiligtum, an unsern mächtigen Kastanienbaum. Schon lange waren in der Familie Stimmen laut geworden, die dem Baum sein Lebensrecht absprechen wollten. Von Jahr zu Jahr breitete er seine Äste weiter aus, verdunkelte unsere Stube, unsere Schlafzimmer, verdeckte uns die Aussicht auf die Straße, saugte dem Gemüsegarten alle Nahrung, alles Licht weg. Heinrich und Mathilde hießen ihn ganz respektlos einen unnützen Fresser, der zu nichts tauge. „Wie schön wäre ein Garten mit einem Spalierhag von Obstbäumen“, meinte Heinrich.
„Wieviel mehr Gemüse könnte man pflanzen und welche Blumen ziehen, wenn dieser Baum nicht wäre“, sagte Mathilde.
Aber diesmal war Vater auf Mutters Seite. „Der Baum bleibt stehen, er ist das Wahrzeichen unseres Hauses.“
„Nein, nein“, wehrte Mutter alle Angriffe auf die Berechtigung seines Daseins ab. „Das ist mein Baum. Unter ihm habe ich euch alle großgezogen. Unter ihm haben wir seit fünfundzwanzig Jahren den Altar aufgeschlagen, in dem Baum liegt ein Segen. Und überhaupt, was müßten die Leute denken, wenn wir so etwas Schönes einfach umhauen wollten wegen dem bißchen Schatten da in der Stube. Nix da, nix da, der Baum bleibt stehen, sonst mag ich in diesem Haus nicht mehr wohnen.“
In eine solche Auseinandersetzung platzte mein Bruder Paul einmal mit der Frage : „Was macht ihr, wenn man euch den Baum einfach eines Tages wegspricht?“
„Wegsprechen?“ fuhr Vater auf. „Wer kann mir den Baum wegsprechen? Der steht auf meinem Grund und Boden.“ Paul lächelte verlegen und überlegen, nun, es könne sein, wenn in Bälde die elektrischen Leitungen gezogen würden, stehe der Baum vielleicht im Wege und müsse dann eben weg.
Da werde er, sagte Vater, wohl auch noch mitzureden haben.
Paul fuhr leise fort: „Da fragt man uns nicht. Wenn der Baum in der Flucht der Leitungen liegt, muß er eben weg.“
Vater wurde bös und schlug auf den Tisch. „Dann reiße ihnen ihre Drecksleitung herunter.“
Paul schwieg. –
Es kam, wie er befürchtet hatte.
Eines Tages erschien ein baumlanger Mensch in der Stube, ein Mensch mit Lederjacke, Ledermütze, gewichsten braunen Gamaschen, legte zwei Finger an den Mützenschild, warf eine Brieftasche auf den Tisch, kramte in Papieren und zu Vater gewandt fragte er: „Sie sind doch Herr Rainer, Besitzer dieses Grundstücks hier bis zur Straße? – Gut. Ihr Baum da muß weg. An seine Stelle kommt ein Verteilermast für die umliegenden Häuser.“
Er zog ein Papier heraus, schwenkte es, daß es sich selbst entfaltete. „Hier ist die Verfügung. Die Elektrizitätsgesellschaft ist berechtigt – – ach, lesen Sie selbst. Den Wisch können Sie behalten. In vierzehn Tagen, das ist das Wichtigste, muß der Baum fort sein. Sie können Einspruch erheben, wo und wie steht auf dem Zettel. Wert hat es keinen, das sage ich Ihnen schon voraus. Falls Sie sich weigern, wird der Baum auf Ihre Kosten von meinen Leuten gefällt.“ Er sammelte seine auf den Tisch geworfenen Papiere zusammen, steckte sie in seine Mappe, steckte die Mappe in die Lederjacke und tippte, sich bereits zur Tür wendend, wieder an seinen Mützenschild.
Vater hatte noch kein Wort geredet und hielt den Zettel in der Hand. Aber Mutter fuhr auf: „Halt, halt. So schnell geht das nicht!“ Der Mann, schon die Hand am Türgriff, wandte sich zurück.
Mutter stotterte: „Aber das geht doch nicht so. Da kann man nicht einfach sagen, der Baum muß weg. Das –“ Der Mann unterbrach sie: „Ich sagte ja eben, wenn Sie Einspruch erheben wollen, können Sie das ruhig tun, Frau. Alles steht auf dem Zettel. Guten Tag.“
Der Baum fiel. Jetzt erst, als er gefallen war, erwachte Vaters Zorn. An einem Tag mußte er zusammengesägt werden. Kein Stück durfte übrigbleiben. Er zerspaltete ihn zu Kleinholz, wuchtete tagelang an dem Stumpf herum, bis er ihn samt allen Wurzeln herausgerissen hatte. Auch dieser wurde sofort zu Kleinholz gemacht, das Reisig zu Büscheln gebunden, bis alles weggefegt war, als wäre nie ein Baum an diesem Platz gestanden.
Bald kamen Monteure und errichteten an seiner Statt einen Masten, zogen Drähte nach allen Seiten in die Häuser. Durch alle Straßen liefen die Drähte. Sie gingen aus von einem geheimnisvollen Häuschen ohne Fenster mit eiserner Tür. Wie oft legte ich mein Ohr an diese verschlossene Tür, hinter der die Geheimnisse einer neuen Kraft ein Lied summten, das Lied von der neuen Zeit.
Die alte Zeit war aus Gottes Hand gewachsen wie unser Kastanienbaum und hatte die Menschen eingeschattet mit dunklen Geheimnissen von überirdischen Dingen, daß sie unter der Wucht von Angst und Ehrfurcht niederknieten und nach den Lichtstreifen und blauen Himmelsflecken erlösender Gnade Ausschau hielten. Die neue Zeit wuchs aus den Händen der Menschen und wollte das Licht an sich reißen, wollte Helligkeit und Klarheit, hieb das Blattwerk des ewigen Lebensbaumes kühn auseinander und zwang die Augen, mitten in die Sonne zu sehen, bis sie halb erblindet die eigenen Pfade für die weitausholenden Schritte nicht mehr erkennen konnten.
Ich habe den Tod der alten Zeit noch erlebt. Ich sah zu, wie die Brunnen des Dorfes, diese sorgsam gehüteten Heiligtümer unserer Väter, mit Bauschutt, Gerümpel und zusammengefegtem Urväterhausrat zugeschüttet wurden, wie die alten Erdöllampen in die Rumpelkammer wanderten, wie die gelbe Postkutsche mit dem blaubefrackten Postillon von der Landstraße verschwand und einem großen braunen Omnibus Platz machte, wie im Rotbachtal, wo wir einst unsere Drachen steigen ließen, ein ganzer Mastenwald von Überlandleitungen sich erhob mit unzähligen, nach allen Himmelsrichtungen auslaufenden Drähten, wie noch die Schnitter vor Sonnenaufgang durch Wiesen und Ährenfelder schritten und Vater jedesmal, bevor er den ersten Sensenhieb tat, den Hut zum Gebet abnahm, bis die Mähmaschinen mit ihren Messerbalken die Schwaden hinlegten in einem solch rasenden Tempo, daß es jedem Bauern Lust und Liebe verschlug, stundenlang Schritt vor Schritt und Hieb um Hieb sich abzumühen. Noch höre ich den Takt der Dreschflegel wie aus ferner Traumerinnerung, sehe im Geiste die eisernen Zugwalzen, an denen Mensch und Tier in der Scheune auf und ab über Stroh und Ähren stapften, bis das große, rosafarbene Ungeheuer der Dreschmaschine an einem einzigen Tag die Arbeit von Wochen und Monaten verrichtete. Die tägliche, immer gefürchtete Plage des Futterschneidens erledigte auch eine Maschine. Im Hofraum stand nicht mehr wochenlang mein Vater mit gekrümmtem Rücken bei Wind und Wetter am Sägbock, eine Sägmaschine nahm die Arbeit ab. Küche und Keller, Stall und Scheune, Stube und Kammer waren bei Nacht, die wir früher mit flackerndem Kerzenlicht oder trüber Erdöllampe nur notdürftig erhellen konnten, keine Zufluchtsorte mehr für Schatten und Schemen. Eine Drehung des Schalters warf Licht in die letzten Ecken und Winkel. Alle diese Wunder gingen aus von dem steifen, kahlen Mast, der an der Stelle des Kastanienbaumes stand und von irgendwoher unsichtbare Kräfte durch dünne Kupferdrähte in die Häuser schickte. Wie groß war mein Staunen, wie tief mußte ich nachdenken, als Paul mir erzählte, unsere Birkach liefere diese Kraft; sie sei am Unterlauf aufgestaut, treibe dort eine Turbine, die Turbine treibe einen Dynamo und der Dynamo sende einen Strom durch die Drähte zu uns zurück, so daß man sagen könne, die Birkach treibe unsern Elektromotor, spende uns das Licht und helfe uns somit bei der Arbeit. Es waren Zusammenhänge, die über mein Begreifen gingen.
Die Neuerungen kamen rasch und unaufhaltsam. Unser Tierarzt Seipel fuhr eines Tages mit einem rotlackierten, ratternden, stinkenden Wagen ohne Pferde vor. Wir umstanden das komische Vehikel, das zitterte und bläuliche Wolken ausstieß. Paul, der oft abends über Katalogen saß, zeigte mir Bilder von Fahrrädern mit Motoren, von Flugzeugen und Zeppelinen.
Meine Mutter hörte nicht auf, in düsteren Worten diese Entwicklung zu geißeln. Sie sah darin etwas Teuflisches, etwas Gottloses, das Frömmigkeit, Glaube, Sittlichkeit langsam wegfrißt. Sie redete vom baldigen Untergang der Welt. So etwas hatte sie in der „Stadt Gottes“, ihrer Lieblingszeitschrift, gelesen. Sie ließ mich ein Bild sehen mit der Überschrift „Gestern, heute und morgen“. Es war eine allegorische Darstellung. An einem Tisch sitzt ein Engel dem Höllenfürst gegenüber. Auch der Teufel war als Engel dargestellt, nur schwarz und mit einem dunklen, boshaften Gesicht. Beide sitzen bei einer Schachpartie, die zugunsten des Teufels auszugehen scheint, denn eben hat er die Hauptfigur, die Königin, seinem Gegenspieler geraubt. Der Engel sitzt mit aufgestütztem Kopf sinnend und traurig da, während Satan ihn von unten her lauernd und siegesgewiß beobachtet. Mutter erläuterte, das Schachbrett sei die heutige Zeit, Engel und Teufel würden hier im Spiele entscheiden, wem die Zukunft gehöre. Ich habe das Bild nie vergessen. [255-268]
Das erste Ich-Erleben
Alles, was ich gesehen und erlebt hatte, war heute besonders tief in mich eingedrungen. Ich konnte auf dem Heimweg nicht neben meinen Eltern hergehen. Ihre Unterhaltung störte mich. So blieb ich einen guten Steinwurf hinter ihnen. Ich hatte Mühe, die vielen vielen Eindrücke, die so ungewohnt und gegen alles Selbstverständliche gerichtet waren, unter meinem geistigen Dächlein zusammenzuhalten. Besonders das Blindsein und die Frage, wie diese Menschen nur ohne Augen leben können, war mir jetzt, da ich durch einen kleinen Spalt in ihr Inneres hatte schauen dürfen, zum erstenmal als ganz schweres Rätsel vor die Seele geführt. Noch nie hatte ich ernstlich darüber nachgedacht. Ich stellte mir vor, wie es mir als Blindem zumute wäre. Mit geschlossenen Augen versuchte ich ein Stück Weges auf der Landstraße weiterzugehen. Alles war nächtig. Wie konnten Menschen diese immerwährende Nacht ertragen? – Oder, wie ist das, wenn man nicht sprechen und hören kann? nicht singen, schreien oder mit Kameraden schwatzen? Und trotzdem waren diese Menschen fröhlich. Sie lachten, spielten, konnten mit den Fingern lesen. – Wie war das möglich? All das kreiste und wirbelte in meinem Kopf. Ich war in einem Zustand gänzlicher Verlorenheit und Einsamkeit. Ein Angstgefühl kroch in mir hoch. Ich tappte vor mich hin, Schritt vor Schritt, die Blicke auf das rote Porphyrpflaster des Straßenbelages gerichtet. Ich sah meinen Beinen zu, wie sie gingen, sah zu, wie immer ein Schuh hinter dem andern abwechslungsweise unter meinem Körper hervorkam, eigentlich ohne mein Zutun. Ich sah, wie das Straßenpflaster unter mir wegwich, und in diesem Tick-Tack der Schritte überfiel mich mit einem Mal ein unheimlicher Gedanke. Ich blieb stehen, schloß die Augen, drückte mit den Händen die Ohren zu und versuchte, mir vorzustellen, ich besäße weder Arme noch Beine, weder Augen noch Ohren noch Zunge. Was dann? Die Bängnis schwoll zu einem Entsetzen an. Es überkam mich eine Art Krampf. Mein Puls pochte zum Zerspringen. Eine fürchterliche Finsternis umhüllte mich.
Und da, mitten in diese Nacht hinein, in dieses Brodeln, Quirlen, Brausen von Angstgefühlen, die zuckend meinen Körper überschauerten, fiel blitzartig die erste Grenzfrage des Daseins: Wer bin ich? Wie ein Funke glomm ein Licht hinter meinen geschlossenen Lidern auf, wurde größer und größer, kam auf mich zu, nur ein Licht. Aber es war so grell und überflutete mich wie Gischt von einem Wasserfall, daß ich bebend dastand. Es war mir, als könnte ich die Augen nicht mehr öffnen, die Hände nicht mehr von den Ohren nehmen. Ich stand mitten in einem leuchtenden Meer, und ein ständig wachsendes Sausen und Schäumen erfüllte meine Ohren. Wer bin ich? Ängstlich öffnete ich die Augen, nahm die Hände von den Ohren, stand da, sah mich um, sah eine Straße, sah Bäume, Äcker, den Wald und voraus zwei Menschen. Alles war mir fremd, rätselhaft, geheimnisvoll. Ich traute mich erst keinen Schritt weiter und stampfte auf die Straße, ob sie noch fest sei. Ich murmelte meinen Namen: „Florian“. Warum heiße ich Florian? – Wieder schloß ich die Augen. Das Licht war fort. Ich wartete, ob es nicht wieder zurückkäme. Es kam nicht mehr. Ich machte einige Schritte. Warum gehe ich? – Weil ich will. – Kann man auch gehen, wenn man nicht will? –Ich versuchte es, gab mir mit der Hand einen Stoß in die Kniekehle, als wollte ich den Fuß zum Gehen antreiben. Er ging nicht. Jetzt will ich gehen. Er ging. Ich machte wieder einige Schritte und blieb stehen, schloß wieder die Augen. Wenn nur das Licht wiederkäme! Ich dachte an mein Elternhaus, an den Kastanienbaum. Ich stellte mir den Baum vor. Aber er ist doch weg. Es steht kein Baum mehr dort. Wie kam es, daß der Baum in meinem Kopf stand? Wie ist das, daß etwas im Kopf ist, was nicht mehr ist? – Warum kann man überhaupt innen sehen? im Kopf, bei Nacht, im Traum? Können das Blinde auch? – Was ist im Kopf? Wer tut das, dieses Sehen, Hören, dieses Spielen mit den Dingen? Wer tut das? – Tu ich das? – Wer ist dieser Ich? Ist das derselbe wie Florian? Nein, Friedel sagt auch „ich“. Mathilde auch. Jeder sagt „ich“. – Wer ist dieser Ich? – Es war mir, als sei durch einen dünnen Riß meines Gehirns eine Fontäne zum Himmel geschossen, eine Lichtfontäne, die jetzt einen Platzregen von Fragen über mich ausschüttete.
Das tollte in meinem Kopf wie ein Wirbelwind im Herbstlaub, das fegte hin und her, auf und ab, strudelte, flatterte und geisterte, als wäre mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Die ganze festgefügte Welt geriet ins Wanken. Der ewige Baum des Daseins hatte seine Blätter fallen lassen und dem Sturm der Seele übergeben, dem Sturm eines ungesättigten, unersättlichen Wissensdurstes.
Die Eltern waren jetzt weit voraus und näherten sich bereits den ersten Häusern meines Heimatdorfes. Mit eins wehrte ich diesen wilden Bremsenschwarm von Fragen ab, lief ihm einfach davon, lief und lief, bis ich endlich die Hand meiner Mutter als einzigen festen Halt verspürte und sie nicht mehr losließ. Sie sah mich erstaunt an. „Was hast du denn? Bist du müd? Du siehst so bleich und verstört aus.“ Ich schwieg und drückte nur noch fester ihre Hand. [...]
Meine Abneigung gegen den geistlichen Beruf war durch diese Erlebnisse nicht vermindert worden. Ich wurde nicht frömmer und ging auch nicht mit größerer Freude zur Kirche. Aber etwas anderes brach wieder auf, das seit meinem sechsten Lebensjahr, als ich die Enttäuschung mit meinem Schutzengel erlebt hatte, wieder eingeschlummert war, das fast krankhaft quälerische Grübeln und Rätseln an den Dingen. Die Frage, die mich auf dem Heimweg von Mariabronn überfallen hatte, die Frage „Wer bin ich?“ stand jetzt hinter jedem Schritt und Tritt. Ich wurde von einem Mißtrauen gegen die Welt erfaßt, Mißtrauen gegen die Menschen, Mißtrauen gegen jede Betätigung, Mißtrauen gegen mich selbst. Ich fühlte ein Geheimnis in mir, das ich mit mir herumtrug, ohne sagen zu können, was es war. Florian und ich, soweit kam ich zuletzt, sind zwei ganz verschiedene Menschen. Warum kann man mit sich selbst reden? sagte ich mir vor dem Spiegel. Warum kann man zu sich selbst sagen: Florian, das hast du falsch gemacht, Florian, bist du ein Dummkopf, Florian, schau mal an dir hinunter, deine Beine, deine Füße, dein Bauch. Warum kann man das? – Es gibt zwei Menschen im Menschen, einen kleinen und einen großen. Der kleine Mensch, der trägt einen Namen, der heißt Florian oder Hermann oder Frieda, Bärbel, Mathilde. Aber der große, der ist namenlos. Der sagt immer nur „ich“. Er sagt bei jedem Menschen „ich“. Florian, das war der Mensch unter den andern, der auf Fahrrädern fuhr und Rennfahrer werden wollte. Das war der Schüler, der Rainerbub, der aß und trank und schlief und ins Feld ging. Solange er das alles tat, schlief der andere, da war er fort. Sobald man aber allein unter einer Hecke lag oder im Moos zu den Ästen der Tannen hinaufblinzelte oder an der Birkach entlangsirmelte und nicht wußte, was man mit sich selbst anfangen sollte, da konnte er plötzlich aufwachen, der andere, der „Wer bin ich“. Dann fing er an, besonders, wenn man die Augen schloß. Wer bin ich? Und wie aus einer Sonne heraus schossen die Strahlen nach allen Seiten. Jeder Strahl war eine Frage. Jede Frage löste ein Mißtrauen aus. Alles zweifelt er an, dieser „Wer bin ich“. Das kann ganz schlimm werden. Das Herz kann plötzlich erschrocken aussetzen. Er sagt: dieser Bach ist kein Bach, er hat ja kein Wasser. Ein Bach ohne Wasser ist kein Bach. Nein, das ist kein Bach, sagt der Florian. Wie nennt man einen Bach ohne Wasser? Oder er sagt: wieviel Wasser braucht der Bach, daß man Bach zu ihm sagen kann? Oder er sagt: der Rotbach ist ein Bach, auch die Birkach, aber später wird die Birkach ein Fluß. Wo hört der Bach auf und wo fängt der Fluß an? – Oder er sagt: deine Mutter ist deine Mutter. Woher weißt du das, daß es deine Mutter ist? Hat sie dich wirklich geboren? Warst du dabei, als du geboren wurdest? Hast du das gesehen, erlebt? Also, woher weißt du es? Die andern haben es dir gesagt. Aber die andern können auch gelogen haben. Wer ist denn deine Mutter? Das alles ist gar nicht so sicher, wie du denkst. Nichts ist sicher. – Plötzlich sagt er: es gibt nur einen Menschen, das bin ich. Schließe deine Augen und sag dir, es gibt nur einen Menschen. Alles andere ist nicht wahr, was du siehst. Du bist ganz allein, Florian! Es gibt nur einen Menschen, das bin ich. Das bist du, sage ich zu diesem „Wer bin ich“. Nein Florian, das bin ich. Ja, ich sagte doch eben, das bist du. – Nein, ich bin es, du bist auch ich. Es gibt nur einen Ich.
Als dieser Ich mir gar zu sehr zusetzte, nahm ich meine Zuflucht zu dem Wort Gott und sagte: Aber Gott gibt es. Ihn gibt es sicher. Es wurde ganz still um mich her. Da war es wieder, das Licht hinter meinen geschlossenen Augen, nicht mehr stark, es war ein schönes, mildes Licht wie von einer Erdöllampe hinter einem Milchglas ... Ja, Gott gibt es, sagte ich mir und empfand einen großen, starken Trost, eine wunderbare Erlösung. Das war Halt und Gewißheit, fest verankert in einem Glauben, den mir Mutter wie eine Pfahlwurzel in die Seele gesenkt. Ja, Gott gibt es. Aber dieser Ich hatte auch hier sein Fragezeichen: Wer ist Gott? Wo ist Gott? Wie ist Gott? Weißt du das? [308-314]
Das Geheimnis der Hostie
Im ersten Jahr meiner Ministrantenzeit wurde ich für die erste heilige Kommunion vorbereitet. Pfarrer Geißelmann nahm diese Vorbereitung überaus gründlich. Dabei sank seine Stimme bisweilen zu einem tiefen Flüstern herab. In seinem Tonfall lag ein Schauern, als erzählte er Geistergeschichten. Ich glaube, am liebsten hätte er jedem von uns unter vier Augen den Unterricht erteilt, um ja die letzten Winkel der Seele mit dem Licht des Mysteriums zu füllen.
Auf diese Weise erfuhr ich das Geheimnis der Eucharistie.
Christus ist gegenwärtig im Altarsakrament. Christus ist Mensch und Gott zugleich. Ein Mensch ist gegenwärtig mit Fleisch und Blut in der kleinen Hostie. Er ist darin ganz enthalten. Ein ganzer Mensch mit Haut und Haar und Fleisch und Blut, mit Kopf und Händen und Leib und Bein und Fuß. Im winzigsten Partikelchen der Hostie ist er drin. Und das ist nicht nur ein Mensch. Er ist der Sohn Gottes, er ist wie Gott Vater selbst, Gott, der alles geschaffen hat, was man sieht und hört und greift und ißt und trinkt, der alle Tiere, alle Pflanzen, alle Menschen, Erde, Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat. Er ist in der kleinen Hostie ganz enthalten. Ein Gott und ein Mensch, beide eins und enthalten in einer winzigen, dünnen, weißen Scheibe Brot. Und dieser Gott in der kleinen Scheibe kommt zum Menschen, wird von ihm gegessen, kehrt ein, nicht nur in seine Seele, sondern auch in seinen Leib, so daß man, wie Pfarrer Geißelmann uns belehrte, sagen könne, nach der Kommunion sei jedes Kind ein Gottesträger und sei wie eine goldene Monstranz vor dem Angesicht des Allerhöchsten.
Ich lauschte diesen Ausführungen Wort für Wort, Satz für Satz. Alles kam mir so ungeheuerlich vor, so alle Fesseln des Verstandes sprengend, so gewaltsam sich zwischen die Sinne und den Glauben an das Wirkliche einzwängend, so über alle Maßen unmöglich zu verstehen, daß man nur noch glauben konnte. Der eine Mensch in mir, der Muttermensch, sank nieder in Ehrfurcht, Lust und schwärmerischer Hingabe an das große, allwaltende Geheimnis. Hier tat sich ein Wunderschrein von Rätseln, von märchenhaften Strahlungen, von unerhörten Weiten auf. Es war wie das Entzücken beim Betreten eines Gotteshauses an Hochfesten, an Weihnachten oder Fronleichnam. Dieser Muttermensch, der durch meinen Altardienst wieder erwacht war und der in der Überschwänglichkeit seiner Seele alles aufnahm, was ihm schön und rein und erhaben entgegenkam, der nicht fragte, nicht zweifelte, nicht den Kopf zurückwarf, der sich einfach in den warmen Strom der Gefühle hineinziehen und sich treiben ließ in die uferlose Weite seiner Phantasie, er glaubte.
Doch der andere Mensch stand auch auf in mir, der Vatermensch, der Dickkopf, der Querkopf, der Augenmensch, der die kleinen Flügel der Libellen, der Motten und Käfer betrachtete, der „Wer bin ich“, der an allem zweifelte und eine Formel in der Hand hatte, wie ein Schwert. „Weißt du das?“ hieß diese Formel. „Weißt du das genau? Hast du es selbst gesehen, gehört?“ Er sagte nicht: „Florian, das ist unmöglich.“ Er behauptete nie etwas, er ließ alles offen, war aber ganz versessen darauf, daß alles offen blieb. Er fragte nur: „Weißt du es? Weiß es der Pfarrer? Ist er allwissend? Denk an die Kirchenwächter! Hat er das gewußt, daß sie falsche Angaben machten? Wenn es aber nicht so ist? Wenn auch der Pfarrer nichts weiß? Wer ist Gott? Hast du ihn je gesehen? Hast du ihn gehört? Ein Mensch mit Fleisch und Blut in einer Hostie? Denk darüber nach. Du mußt immer fest denken, Florian!“
Es war etwas Starres, Halsstarriges, Unbeugsames an diesen Fragen, etwas Nackensteifes, Wildes, Verführerisches, eine Lust zu trotzen, nein zu sagen, einfach nein und nein und wieder nein. Ahnte ich vielleicht schon dunkel, daß es bei dieser Eucharistie, bei diesem Glauben an die Gegenwart Gottes im Altarsakrament, um den Prüfstein des Glaubens überhaupt geht, um den letzten äußersten Akt des Gehorsams, wo der Mensch einfach Auge, Ohr und Mund zuhalten muß, um blind hinzusinken mit jenem verzweifelten Ausruf: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Ahnte ich diesen Prüfstein der Religion, jeder Religion, diese Unterwerfung unter das Geheimnis, unter das Unbegreifliche, Unsinnige, Gegenwirkliche, wo der Mensch gezwungen wird, gegen Auge und Ohr, gegen jeden Sinn zu bezeugen?
Vielleicht konnte mir Mutter helfen? Sie war in dieser Zeit der Vorbereitung auf die Kommunion immer um mich. Sie hörte mich den Katechismus ab, erklärte mir Wörter, die ich nicht recht verstand. Aber es war immer nur jene Mutter, die zur Kirche ging, Rosenkränze betete und ängstlich sich an die Gebote hielt. Sie hatte nie ihre große Stunde, ihre heilige Stunde, da sie ganz frei war und aus sich schöpfte und die Sorgenlast abgeschüttelt hatte.
An einem Sonntagnachmittag, es war, obwohl erst Ende März, schon sehr warm, nahm sie mich an der Hand. „Komm ein wenig mit mir!“ sagte sie, „es ist so schön draußen.“ Sie führte mich, ich wußte es schon im voraus, zu ihrem Lieblingsplatz, dem Mooswäldchen.
Es lag einiges Stammholz dort. Sie prüfte es mit der Hand. „Es ist ganz warm, komm, sitz daher.“ Wir setzten uns auf einen Stamm. Rings um uns her waren eine Menge Tannenzapfen, aufgebrochen, dürr und offen. Das Dorf lag in der Ferne vor uns. Der spitze Kirchturm ragte in den blauen Himmel. Die Wiesen, noch graubraun und wie verdorrt, zogen sich in breitem Band entlang dem Rotbach bis zum Dorfe hin. Es war ganz still. Mutter bückte sich, nahm einen sperrig offenen Tannenzapfen in die Hand und spielte damit. Einige Samen fielen heraus. Sie stieß die Spitze des Zapfens gegen die Höhlung ihrer linken Hand. Die gefiederten Samen raschelten aus den Schuppen.
„Schau, wieviel da herauskommt.“ Sie stieß wieder und nochmals, ließ den Zapfen fallen und strich mit der rechten Hand die Samen zu einem Häufchen zusammen, wühlte darin, vorgebeugt und ganz in Gedanken versunken.
Nach einer Weile fragte sie: „Freust du dich auf den Kommuniontag?“
Ich gab nicht gleich Antwort.
„Warum freust du dich nicht?“
„Ich freue mich doch, Mutter.“
„Nein“, sagte sie, „es ist noch etwas in dir. Ich spür es. So etwas spürt eine Mutter.“
Ich schwieg.
„Du wehrst dich, du machst Sperrfüße. Gegen was wehrst du dich?“
Ich wollte nichts sagen, konnte es wohl auch nicht in Worte fassen.
Nach einer Weile sagte sie: „Es ist etwas Großes, dieser Tag. Vielleicht verstehst du das noch nicht so ganz.“
„Nein, Mutter“, sagte ich leise, „ich verstehe es noch nicht so ganz. Wenn der Pfarrer es sagt, verstehe ich es, aber nachher nicht mehr.“
„Was verstehst du nicht?“ fragte sie ebenso leise.
„Das, das ...“ stotterte ich, „alles das mit Gott und der Hostie und daß Gott in der Hostie sein soll. Wenn er es sagt, der Pfarrer, ist es mir klar. Aber nachher –“
Sie ergänzte: „Ja nachher kommen die Zweifel. Kind, das geht mir auch so. Wenn ich in der Kirche bin, ist mir alles klar und da kann ich fromm sein. Aber daheim. O Kind, das verstehe ich. Darum mußt du bald in ein christliches Haus. Daheim ist alles so weltlich und das frißt immer das Beste weg. Es geht dir wie mir. Es ist die Luft. Vater, Mathilde, Heinrich und besonders Paul.“ Sie schwieg. „Nun“, fügte sie hinzu, „es ist überall so, in allen Bauernhäusern. Bauern sind Erdenmenschen, müssen es vielleicht sein. Aber was verstehst du nicht? Daß Gott in der Hostie zugegen ist?“
„Ja, Mutter.“
Sie rührte mit dem Zeigefinger in den Samen des Zapfens herum. „Gott so groß und die Hostie so klein, gelt, das ist es?“
„Ja, Mutter.“
Sie schwieg wieder, rührte in den Samen weiter. Jetzt war ihre Stimme mit einem Male anders. Auch ihre Augen waren es. Sie wurden groß und starr und weit. „Gott so groß und die Hostie so klein“, wiederholte sie. „Schau mal diesen Samen an. Das ist ein Tannensame mit einem Flügel, und ist so klein und doch wird eine Tanne daraus, eine hohe Tanne wird daraus, wenn man ihn in den Boden steckt. Oder nicht?“
„Ja, Mutter.“
„Also kann man doch sagen, die Tanne ist in dem Samen drin, sie ist unsichtbar in jedem Samen drin. Und wenn sie groß ist und weit über hundert Jahre alt, hat sie fast jedes Jahr neue Zapfen und in jedem sind viele neue Samen und jeder könnte wieder eine Tanne werden. Das ist doch ganz einfach.“
„Ja, Mutter.“
„Also sind in dem Samen ganze Wälder drin, und die Wälder hätten wieder Zapfen, viele Millionen, und also könnten aus diesem Samen alle Tannen auf der ganzen Erde wachsen. So viel ist in ihm drin. Schau, Kind, so mußt du dir das denken mit der Hostie. Das ist ein Same Gottes, und wenn der ins Herz gepflanzt wird, wächst der Baum, und er wächst im Glauben, nur im Glauben. Ohne Glauben kann er nicht wachsen. Glaube ist das Wichtigste. Verstehst du das?“
„Ja, Mutter.“
„Glaube ist das Wichtigste.“ Sie ließ die Samen durch die Finger fallen und richtete sich aus der gebückten Haltung empor. „Glaube ist das Wichtigste, nur im Glauben kann Gott wachsen und“ – fügte sie mit einem leichten Stöhnen hinzu – „im Leiden. Glaube und Leid sind wie Acker und Regen.“ Sie hielt einen Augenblick inne, als lausche sie. „Ja richtig, das habe ich vom alten Pfarrer Plochinger. Das hat er mir gesagt, als meine drei Kinder starben. Glaube und Leiden sind wie Acker und Regen.“ Sie sagte es langsam, mit einer gedehnten und dunklen Stimme. Daraufhin umfaßte sie mit ihrer Hand die meine, die neben ihr auf dem Stamme lag. „Bub, du mußt fort von hier. Geh doch zum Onkel Severin. Er kann dir das viel schöner, viel größer erklären. Ich weiß doch, dich treibt es um. So bin ich auch. Mich treiben solche Fragen auch um. Glauben ist schwer. Glauben ist das aller- allerschwerste. Aber, wenn man über den Berg ist, wenn man die Sonne sieht, wird es leichter. Guck, ich meine, du solltest halt Pfarrer werden. Das ist etwas Großes, Schönes, so auf der Kanzel stehen, predigen oder die Messe lesen, Gott in Händen halten, Gott zeigen, austeilen, das muß etwas vom Größten sein. Kind, Kind, Gott austeilen an die andern!“
Sie sprach weiter und weiter, ließ sich hinreißen vom Strom, ihre Hände hoben sich, senkten sich, beschrieben Kreise und Kreuze, stellten Bilder hin, ein Bild an das andere, eines schöner als das andere, ihre Gestalt war wie durchleuchtet. Sie wurde schön, meine Mutter, wenn sie so sprach, sie wurde heilig. Jedes Wort kam aus einer großen Tiefe, jedes hob sie mit den Händen empor, langsam und in Andacht, und ihre Augen glänzten dabei in einem dunklen Licht. Sie war wie eine Prophetin. Sie redete vom Amt des Priesters, kam auf die Primiz ihrer beiden Brüder zu sprechen, erzählte von der Feier im Mentonhaus und wie sie als Mädchen nicht mehr gewagt habe, ihre Brüder mit „du“ anzureden, nachdem sie die Weihe empfangen hatten.
Sie wußte, es war der Augenblick, der entscheidende Augenblick, wo es um meine Seele ging. Ich konnte mich nicht mehr entziehen. Ich konnte nicht mehr nein sagen. Ich selbst war hingerissen und wie betäubt von einem überirdischen Duft. Sie legte ihre Hand auf mein Knie, legte sie in meine Hände, nahm meine Hände in ihren Schoß, drückte sie und sagte zum Schluß:
„Kind, ist das nicht groß?“
„Ja, Mutter.“
Sie blickte mir in die Augen.
„Ja, Mutter“, sagte ich noch einmal, „ich geh zu Onkel Severin.“
Sie nickte und schlang den Arm um meinen Leib. Ich war jetzt ganz in ihr. Ich schloß die Augen. Eine wunderweiche Seligkeit, ein Glücksgefühl überströmte mich, stieg hoch und immer höher, vom Herzen in den Hals, in die Augen, schauerte und flutete auf und nieder. Das Licht war wieder da. Das große Licht. Wie in warmen Schaum und Flaum gebettet kam ich mir vor. Am liebsten hätte ich die Augen nicht mehr aufgetan...
Mutter nahm den Arm weg. Der große Augenblick zerfiel, wie ein schöner Traum zerfällt, man will noch geschwind das Letzte erhaschen, aber das Licht der Wirklichkeit verbrennt ihn.
Es ist wie beim Baukastenspiel. Einen Turm hat man gebaut, hoch und immer höher die Steinchen gesetzt, und je höher man kam, desto klopfender wurde das Herz über dem Gelingen, noch ein letztes Steinchen auf die Spitze, die Hand, die es hält, fängt an zu zittern, berührt den Bau, es fällt ein Stein, man will ihn halten, aber schon wankt das Ganze, bricht zusammen, und plötzlich ist’s, als müßte man selbst zerstören, und fegt es weg, vertilgt die letzte Spur und streut die Steine auseinander.
Ich hatte in dieser Stunde am Herzen meiner Mutter das Letzte genossen, was ein Erdenmenschlein an himmlischen Dingen genießen kann. Meine Erwartung, es sei nur der Vorhimmel gewesen und es werde noch viel viel höher gehen auf der schmalen, brüchigen Leiter kindlichen Verstehens bis hinein ins Innerste des Lichts, wenn ich ihn am Kommuniontage empfing, ihn, den Samen Gottes, bei mir tragen durfte als wandelnde Monstranz, wie Pfarrer Geißelmann sagte, erfüllte sich nicht. Der Bau, den Mutter in mir aufgetürmt, so erdenfern und himmelsnah, war schon wieder am Einstürzen und stürzte dann auch unter wenigen Stößen zusammen.
Wir hatten hinter dem Rücken des Vaters und des Vatermenschen in mir einen Pakt geschlossen, hinter dem Rücken der nackten Wirklichkeit. Das Leben zerriß ihn in Fetzen. [321-327]
Sünde und Kommunion
Die Leute schluchzten und weinten. Auch Männer rieben sich die Augen, wie wir so gemessen, so geschmückt, so ernst und langsam durch das Mittelschiff der Kirche schritten, voran die weißen Mädchen, jedes von uns mit einer brennenden Kerze in der Hand.
Mein Gewissen schlug immerfort dumpf und hohl: Florian, du hast gegessen und getrunken und gelogen. Florian, du darfst nicht an die Kommunionbank. Ich kam mir vor wie ein zum Tode Verurteilter.
Ich hatte nur den einen Gedanken, was wohl passieren würde, wenn der Pfarrer die weiße Oblate auf meine unwürdige Zunge legte. Viele Geschichten waren uns im Unterricht erzählt worden, wie Gott solche Sünder oft auf der Stelle mit dem Tod bestraft habe, so daß ihre Seele von der Kommunionbank weg geradewegs zur Hölle fahren mußte.
Schrecklich stand sie vor mir, die große Sünde. Wie eine Schlange, wie ein Drachen kam sie auf mich zu.
Vielleicht trifft dich ein Blitz oder ein Herzschlag. Eine entsetzliche Angst bemächtigte sich meiner. Mein Herz pochte zum Zerspringen, meine Schläfen wurden feucht.
Was sollte ich tun? Ich kniete zwischen meinen Kameraden, die andächtig die vorgeschriebenen Gebete in den Büchern lasen. Alle sahen so friedlich und gesammelt aus, selbst jene beiden, die am Abend zuvor mich auf der Straße verprügelt hatten.
Immer näher rückte der Augenblick heran. Ich konnte nicht beten. Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen.
Auf einmal spürte ich eine Übelkeit aus dem Magen aufsteigen. Wie das Grollen eines nahenden Gewitters fing es in mir zu rumoren an. Abwechselnd überliefen mich heiße und kalte Wellen.
Das Seifenwasser schien jetzt etwas spät, aber noch nicht zu spät, seine Wirkung zu tun.
Mir wurde sterbenselend. Ich mußte die Kirche verlassen. Umständlich stieg ich über die Beine meiner Kameraden weg, tastete mich wankend von Kirchenbank zu Kirchenbank und erreichte mit knapper Not den Ausgang.
Während ich mich am Blitzableiter krampfhaft festhielt, überschlug sich mein Magen derart, daß mir vor Weh die ganze Welt ins Wanken geriet.
Mein Vater mußte von der Empore aus mein Weggehen beoobachtet haben. Nach einer Weile stand er neben mir. Er schalt nicht, er brummte nicht, er war nicht böse, sondern faßte mich unterm Arm, nahm mich zum Kirchenbrunnen, wusch mein Gesicht kalt ab und führte mir die eiserne Trinkglocke zum Mund. In diesem Augenblick kam meine Mutter um die Ecke der Kirchenmauer. „Ferdinand! Ferdinand!“ rief sie von weitem, „das Kind darf doch nicht trinken, sonst kann es nachher nicht zur Kommunion.“
Da sprach mein Vater, der dickköpfige, widerborstige Hartschädel Ferdinand Rainer, das erlösende Wort: „Und ich sag dir, jetzt soll der Bub trinken, bis ihm wieder wohl ist, und wenn alle Heiligen vom Himmel herunterkommen. Trink, Florian!“
Ich trank die ganze Glocke Wasser gierig hinunter im befreiten Gefühl, daß die große Sünde, das Ungeheuer, mich nun nicht mehr verschlingen konnte.
Bleich und starr vor Erregung stand meine Mutter jetzt Vater gegenüber. Sie wußte, gegen seinen harten Trotz war nichts auszurichten. Wenn er schon einmal etwas in die Hand nahm, war es nur noch seine Sache, dann führte er sie durch ohne Rücksicht auf Menschenmeinung, Gewohnheit und Gebrauch. Auf alle Vorwürfe meiner Mutter sagte er erst kein Wort. Mutter fuhr fort: „Jetzt kann er nicht mehr zur Kommunion, der schönste Tag seines Lebens ist ihm verpfuscht. Er kann heimgehen, wo soll er sonst hin?“
„Also!“ sagte mein Vater nur, faßte meine Hand, nahm die kleine Hand in seine große Lederhand und führte mich von der Kirche weg, nicht nach Hause, sondern ins Freie. Ich hörte noch Mutters erstickte Stimme: „Florian, Florian!“ ging aber aufrecht an Vaters Seite und hielt seine Hand so fest, wie ich nur konnte. Er schritt langsam aus wie bei einem Spaziergang. Er redete nichts. Er deutete nicht. Er blieb nicht stehen, er setzte Schritt vor Schritt, hart, kräftig und trotzig. Er ließ meine Hand nicht los. Mir aber war, als ginge von dieser Vaterhand eine ungeheure Kraft aus, eine Stärke und Festigkeit, die alles, was in diesen Tagen mein Gemüt zerrissen und aufgewühlt hatte, unter einer kühlen Schneedecke des Friedens begrub.
Wir kamen auf den Klingenbühl, von wo aus der Blick frei ins Land schweifen konnte. Wiesen, Äcker, Waldstreifen, Bäche, Dörfer lagen zu unsern Füßen. Fern am Horizont hoben sich die stumpfen Kuppen der Schwarzwaldberge vom grünlichblauen Himmel ab. Etwas Starkes war in mir und etwas Kühnes. Mit Genuß fühlte ich den festen Boden unter den Sohlen.
Die Vaterhand führte mich weiter, dem Hochwald zu. Er war keine dunkle Mauer mehr, nichts Düsteres oder Drohendes. Die Morgensonne beschien die Tannen. Sie glänzten in einem tiefgoldenen, fast rötlichen Licht. Der Weg, auf dem wir gingen, war gelb bestäubt. Auch die Äcker schimmerten golden. Vom Walde her trug der Westwind dünne Schwaden, wehte sie hoch und ließ sie dem Dorfe zutreiben.
Was war das? Vater blieb stehen, machte eine Handbewegung über den ganzen Wald hin und sagte: „Sie blühen.“
Die Tannen blühen? Jetzt erst bemerkte ich das Wunder. Alle Tannen waren über und über mit purpurfarbenen Blüten bedeckt. Beim Näherkommen sah ich sie zu Tausenden, ja Millionen im Gezweig stehen, und je höher sie den Wipfeln zu standen, desto dichter wurden sie. Alle Gipfel glühten blutrot.
Noch nie hatte ich dieses Naturschauspiel gesehen. Langsam gingen wir auf dem Rasenweg an der Traufe entlang. Unsere Schuhe waren gelb gepudert. Das Grün der Äste war im Pollenstaub verschwunden. In schweren Dolden hingen die Staubgefäße an den Zweigen. Zwischen ihnen standen die violettroten Kerzen der weiblichen Blüten.
Vater bog einen Ast herunter und ließ mich einen Strauß brechen. Daraufhin führte er mich weiter in den Hochwald hinein. Sein Gesicht war zufrieden, seine Augen tasteten wie in Andacht versunken die Stämme ab.
In dieser flügelweiten Einsamkeit des Schweigens liefen meine Gedanken zurück zum Erlebnis beim Mooswäldchen. Ich hörte Mutters Stimme: Also kann man sagen, die Tanne ist im Samen ganz enthalten, und wenn sie blüht, bringt sie neue Zapfen hervor, und in jedem sind wieder neue Samen. Jeder Same birgt in sich eine Tanne. Also ist in einem winzigen Samen ein ganzer Tannenwald, sind viele Tannenwälder, und alle Wälder der Erde könnten mit der Zeit aus einem Samen wachsen. So viel ist in ihm enthalten...
Jetzt begriff ich ganz. Ich stand mitten in dem Wunder, mitten im geheimnisvollen Werden der Wälder. Millionen Tannenblüten leuchteten und schütteten sich aus und neuer Same entstand. Woher kommt das? – Wer tut das? – Warum ist das? – Same Gottes... Ein Schauer durchrieselte mich. Alles ist geheimnisvoll, alles, alles. Was der Pfarrer sagt, ist nicht geheimnisvoller als dieses Wunder hier. Das Schweigen meines Vaters ist so tief wie Mutters Wort.
Da überkam mich die Gewißheit, daß hier ein Wesen waltet, das unendlich größer ist, als Menschenmund und Menschenweisheit auszusprechen vermögen. – Gott ist größer als unser Herz. – Ich aber hatte geglaubt, durch einen kleinen Bissen Marzipan meinen Schöpfer beleidigt zu haben. [339-342]
Die Base, ihr Sohn und die Tochter des Eschhofes
Remigia schwieg. Sie schwieg lange. Als sie fortfuhr, sagte sie erst leise: „Ich erzähle dir das, Hias, damit du weißt, was der Eschhof nur weiß, das, was in jener Nacht geschehen ist, wo Gott mich so versucht hat. So kann kein Teufel versuchen, so kann nur Gott die Menschen auf die Waage legen. Er hat mich gestraft, weil ich das Kind los sein wollte, und legte mich mit gebrochenem Fuß ins Bett. Ich konnte jetzt wählen. Niemand im Haus oder Dorf hatte eine Ahnung, gar niemand. Das Kind war da. Niemand wußte es. Ließ ich es verschwinden, war vor aller Welt meine Ehre hergestellt. Der Bauer hatte fest versprochen, mich zu heiraten. Ottmar hätte seinen Namen bekommen und ich meine Ehre und Achtung wieder. Behielt ich es, war Schande über Schande mein Teil, ja, Hohn und Spott und Gelächter.
Auf diese Waage hat mich Gott gelegt: wähle zwischen Schuld und Schande. Auf der einen Waagschale lag der Hof, auf der andern das Kind, lagst du, Hias.
Kind, Kind! Ich war eine derbe Magd. Ich konnte Hühnern und Gänsen den Kragen umdrehen ohne Wimperzucken. Ich habe Schafe und Lämmer geschlachtet, wenn gerade Not an Mann war. Der alte und junge Rupp konnten kein Blut sehen.
Ich bin mit Pferden ausgefahren und hab gemäht wie ein Bauer. Nein, daran lag es nicht. Ich war auch kein frommes Mädchen, bin selten mehr zur Kirche gegangen, seitdem sie mir den Schandwisch ins Haar geflochten hatten. Ich betete nie, ging nicht mehr zu den Sakramenten. Daran lag es auch nicht. Es ging mir nicht schlecht. Die Menschen waren gut zu mir, besonders der Bauer und Kunigunde, das Mädchen.
Ich lag in der Versuchung. Ich konnte gehen. Niemand wußte, daß ich schon gehen konnte.
Wähle zwischen Hof und Kind, zwischen Schuld und Schande I Denk, Bub, es war mein zweites, das zweite war es und von einem andern Vater.
Ich habe gewählt.“
Sie strich sich über die Schürze, glättete sie wie zum Zeichen, daß alles erledigt und gut und sauber sei.
Der andere im Dunkeln fragte leise: „Hast du dabei nicht an meinen Vater gedacht?“
„Nein“, sagte sie hart. „Ich bin ehrlich, Hias, ich habe nicht an ihn gedacht. Ich war ihm böse, daß er von mir gegangen war, mich so allein gelassen hatte. Das heißt, ich habe nicht so an ihn gedacht, wie du meinst. Aber an etwas habe ich gedacht, an eine Rabenmutter.
Ich habe einmal mit deinem Vater im Walde Holz gefällt. Ich konnte das. Er hat wohl allein die Stämme angeschrotet, aber beim Sägen half ich mit. Und wir kamen an einen starken Stamm. Er mußte sehr tief einschroten und die Wurzelläufe abhacken, bis wir die Säge ansetzen konnten. Zwischendurch verschnaufte er sich, sah am Baum empor und sagte: ,Dort oben ist ein Nest. Wird ein Rabennest sein!’ Er schlug weiter zu. Wir sägten lange. Er mußte drei Keile eintreiben, bis der Baum fiel. Als er dalag, gingen wir zu seiner Krone hin, um nach dem Nest zu sehen. Es war hin. Neben dem Nest lagen drei tote Junge, und weiter, ein Schritt weiter weg, lag die Alte. hob sie auf, sah ihr in die gebrochenen Augen und sagte: ‚Schau, Miga’ – er hieß mich nur Miga – ,schau, sie hat ihre Kerle nicht verlassen, und was hab ich doch an dem Baum herum gehämmert, bis er fiel, aber sie ist sitzengeblieben.’ Und er fragte mich leise: ,Miga, wärest du auch sitzengeblieben?’
Ich weiß nicht mehr, was ich ihm zur Antwort gab. Das fiel mir in dieser Nacht ein. Ja, und ich bin auch sitzengeblieben. Aber der Baum fiel nicht.“
Remigia schwieg wieder und atmete erleichtert auf. Sie holte wiederum aus, nahm einen neuen Faden auf. „Das Leben“, sagte sie, „ist anders, ganz anders, als ihr denkt. Ich muß immer wieder den Kopf schütteln. Ja, es gibt einen Gott, Hias. Aber auch der ist anders, als die Pfarrer sagen. Ich kann die Pfarrer nicht leiden. Ach, was heißt leiden. Ich mag sie schon, aber was sie so reden auf der Kanzel oder im Beichtstuhl, ist kein Leben. Man sollte es anders sagen. Es kommt immer alles ganz anders, als man denkt. Nun, ich muß wohl jetzt noch weiter erzählen. Da glaubst du nun, sie seien über mich hergefallen, die Menschen, hätten mich angespieen und mich verstoßen und zum Tempel hinausgejagt. Es kam ganz anders.
Als ich mich überwunden hatte und dich an die Brust genommen, da war ich wieder ein Mensch. Nein, Hias, ich war ein Tier. Der Mensch in seiner Not und seinem Wahn steht weit unter dem Tier. Das Tier weiß, was es tun muß, der Mensch selten. Er denkt zuviel. Das ist auch mein Laster, ich denke zuviel.
Ich habe bei Tag das Kind zuerst versteckt und ließ den Pfarrer holen. Packst gleich den Stier an den Hörnern, sagte ich mir. Er war einmal in meiner ersten Not gut zu mir gewesen, vielleicht versteht er mich, dachte ich. Der alte Pfarrer kam, er kam an mein Bett. Ich sagte, er solle die Tür schließen, ich hätte ihm etwas zu beichten. Dann wickelte ich dich aus den Windeln und legte dich auf die Decke und sagte: ,Das ist meine Sünde.’ Ich glaube, eine solche Beichte hatte er noch nie gehört.
Und dann erzählte ich ihm meine Nacht. Ach Gott, ich habe keinerlei Kraft gehabt, ihm alles zu sagen. Ich war zu schwach und mußte immer wieder heulen und schneuzen und schlucken. Am Schluß sagte ich: ,Jetzt sollen sie mir eben zwei Strohwische in die Zöpfe flechten und ein Jahr lang über meinen Buckel treten.’
Der Pfarrer Plochinger war ein guter Mensch. Gute Menschen erkennt man erst, wenn man sie eine Wunde verbinden läßt. Er wollte nur eines wissen, ob ich deinen Vater richtig geliebt hätte. Das allein war ihm wichtig. Darauf konnte ich die Hostie nehmen, daß ich ihn geliebt hatte, mehr als mein Leben.
,Mein Gott, Mädchen’, sagte er, ,was mußt du gelitten haben. Jetzt bist du stark, das sehe ich.'
Und dann ging er ins Haus, holte den Bauer, seinen Sohn, den Fridolin, die Kunigunde, die Stallmagd, kurz, alle holte er herein und zeigte ihnen das Kind und sagte: ,Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein auf sie.’
Sie gingen nicht weg, sie blieben alle da und wollten das Kind sehen, und doch zitterten alle und guckten ganz dumm auf den Pfarrer. Er aber sagte: ,Ich werde es hier taufen, hier, in dieser Kammer will ich es taufen, und zwar gleich, sofort.’
Er ließ Arzt und Hebamme kommen, man richtete mein Zimmer her. Am Mittag kam er mit dem Mesner und taufte das Kind. Er selbst übernahm die Patenschaft.
Ich weiß, warum er das tat. Er hatte Angst und Sorge, fürchtete wohl, der Teufel könne an mich herantreten, mich versuchen. Er nahm mir vorher die Beichte ab, und ich mußte ihm fest in die Hand versprechen, nicht zu verzweifeln. Alles andere regle er selbst. [...]“
In abgerissenen Sätzen war dies alles hervorgequollen. Es war sehr selten, daß Remigia erzählte, und Hias, der breite, ungeschlachte, junge Mensch saß daneben wie ein dunkler Klotz. Als jetzt eine lange Pause eintrat, ohne daß sich seine Mutter erhob, und alles so still war, weil die Uhr schon weit über Mitternacht vorgerückt war, sagte er leise: „Mutter, warum hast du mir das erzählt? Du bist doch sonst so – ich weiß nicht, so fremd, mein ich.“
Er hörte sie tief atmen. Sie flüsterte: „Es brach heute auf, weil ich heute den ganzen Tag an deinen Vater gedacht habe. Es ist sein Todestag. Wie alt bist du? Ich glaube fast fünfundzwanzig.“
„Nein, schon darüber.“
„Ja, also vor sechsundzwanzig Jahren war es. O, wie die Zeit doch vergeht, und ich sehe immer noch deutlich die Pferde an der Stalltür und ihre vergeisterten Augen.
Warum ich dir das erzähle? Nun ja, ich denke mehr an dich, als du glaubst, weil ich deinen Vater mehr geliebt habe als den jetzigen Mann. Und schau, Kind, ich muß an euer Glück denken. Der Ottmar kriegt das Haus, die andern sind lauter Mädchen. Die gehen fort. Für die gibt es Männer genug. Aber du hast nichts und bist der stärkste. Auf deinem Buckel könnte man eine Kirche bauen. Und da denke ich, du könntest auf dem Eschhof dein Glück finden.“
Sie schwieg und als Hias auch schwieg, fuhr sie in leidenschaftlichem Tone fort: „Ein großes Glück könntest du finden, ein Glück, wie noch keiner hier im Dorf. Sieh, Bub, ich weiß es in meiner Brust. Ein großes Glück! Und ich weiß auch, wo das Glück wächst. So ein Glück braucht tiefe Wurzeln, und sie sind immer dort, wo einmal Not war und Elend und Blut und Leid und das Schwere, auch Sünde und Schuld und Schmutz , und Schlamm. Das alles kann Gott zusammenrühren und seinen Samen hineinstecken.“
Wieder folgte ein Schweigen. Der Junge rührte sich nicht.
Sie fuhr fort: „Sieh dir doch die Helene an. Bist du denn blind, Bub? Das Mädchen macht nichts aus sich. Du sagst, sie habe zerrissene Kleider an und schmutzige Schürzen und lasse die Haare herumhängen und schief sei sie und schwatze zuviel. Ach, alle Weiber schwatzen zuviel, weil ihr Männer nicht muh noch mäh sagt und man alles mit Zangen aus euch herausholen muß. Aber Helene hat etwas, was ihrem Vater fehlt und wofür man ihn prügeln sollte. Sie liebt ihren Hof. Sie liebt nicht den Besitz. Aber sie sieht, wie alles hinten hott geht und zusammenfällt und abrutscht, und sie steht da, mit aufgesperrten Augen, und will es aufhalten, und es ist zu schwer für sie, dieses Aufhalten. Sie kriegt einen schiefen Rücken, sie kann nicht mehr an Schürzen, Kleider, Haare und Finger denken. O, wie ich das weiß. O, wie ich das nachfühlen kann. Wie war es bei meinem Vater, als er Acker um Acker versoff und verluderte, und sie kamen und das Haus versteigerten und was darin war. Als sie meine Puppen über die Köpfe der Menschen warfen und lachten ... o, wie ich das weiß, wie man dasteht vor der Armut, dem Nichts, und seinen eigenen Vater hassen muß.
[...] Aber das Mädchen ist Gold wert. Sie hat nichts als diesen Stolz, diesen großen Stolz, sie gibt nicht nach. Sie hat noch eine Hoffnung. Die Felder sind ja nicht weg. Sie sind nur verpachtet. Der Wald ist verwildert, der Steinbruch verfallen. Aber alles ist noch da und wartet. Merkst du das denn nicht?“ Sie gab dem Klotz neben sich einen Stoß in die Rippen. „Merkst du das denn nicht, wie alles wartet, die Helene, der Fridolin, das Haus, der Wald, der Steinbruch, die Schafweiden, der Obstgarten? Alles wartet auf dich, auf dich, Hias! Gib der Helene ein gutes Wort und du wirst sehen, andern Tags hat sie eine neue Schürze an. Sei nett zu ihr und sie wird sich bald die Haare kämmen. Sag zu ihr: ,ach das Haus, das kann man aufrichten, das ist nicht schlimm, und sie wird aufleben und lachen. Nimm ihr eine Last ab und ihr Rücken wird wieder gerade werden. Mach einen kleinen Spaß mit ihr und sie wird eine ganze Nacht vor Freude nicht schlafen können.“
Der Klotz, der dunkle Klotz neben der Mutter schwieg. Aber ihr Wille war über ihm, ihr Mutterwille und Mutterbann, und sie fühlte, wie man es bei einer Säge fühlt, daß sie zieht, fühlte, es lohnt sich, es schlägt an, es geht tief, es bohrt und meißelt und gräbt und senkt sich ein. Sie ließ ihn nicht los, sie redete weiter. „Aber ich weiß, ihr Jungen habt keine Augen für Mädchen, keine Menschenaugen, die weiter sehen und durch das Fleisch hindurchsehen, durch die Rippen bis ins Herz. Ihr habt nur Tieraugen. Das muß rote Backen haben und Fleisch hinten und Fleisch vorne und rund hinten und vorne und oben und unten und muß kichern und schäkern. Aber das sind doch keine Mädchen, keine Menschen. Menschlein sind das, Tierchen, Schäfchen, dumme Gänse. Aber Helene! Sie ist noch gar kein Mädchen gewesen. Sie durfte es nicht sein. Sie ist Magd im eigenen Hof, weniger als das, eine häßliche Hauswurzel, ein krummer Stützbalken, weil die Last zu schwer für sie ist. Das muß man sehen. Sie ist ein armes Kätzchen, das in Wind und Wetter und Regen und Seelenhunger herumläuft. Kein Mensch frägt nach ihrem Herzen. Ich hab sie einmal angerührt, nur auf der Schulter, und hab etwas Freundliches zu ihr gesagt, gleich schossen ihr die Tränen aus den Augen. [...]“
Und Helene? Ja, diese Helene war ein eigenartiges Mädchen. Sie wich drei Jahre nicht von der Seite des Burschen. Sie schleppte ihm drei Jahre lang Ziegelsteine herbei und rührte Mörtel an und wuchtete am Maurerkübel herum und trug Essen in den Steinbruch, wenn Hias im Winter dort arbeitete. Sie trug Essen in den Wald, wo er mit Ottmar Bäume fällte. Sie brachte die Pferde an den Wagen, sie schirrte ein, schirrte aus, fütterte und molk und kochte und war wie ein Windsegel immer gebläht von Arbeit. Sie huschte immer, sie atmete immer fliegend und zog auch keine gute Schürze an, auch keinen sauberen Rock und kämmte sich nicht öfter. Aber sie hatte Freude im Gesicht und eine schöne, auflebende Röte unter den Augen. Sie sagte wie immer: „Hias, hier steht der Mostkrug ... Hias, du mußt jetzt etwas essen ... Sind diese Steine richtig, Hias? ... Was meinst du, Hias, soll ich jetzt noch mehr Steine holen oder. reichen sie?“
Der Maurer sah sie wie sonst an. Er war nicht freundlicher zu ihr und gab ihr keine besseren Reden und schwieg meist auf ihr Geschwätz. Aber sie wurden Kameraden. Sie konnten nebeneinanderstehen, eine Arbeit betrachten und miteinander lachen. Er konnte sie rufen und sagen: „Wo steckst du denn so lange? Rühre etwas mehr Speis an. Das ist doch zu viel Wasser. Du gießt immer zuviel Wasser dazu.“
„Ach ja, Hias“, sagte sie. „Ich will es ja recht machen.“
So lebten sie nebeneinander, ohne daß etwas vorgefallen wäre, ich meine etwas Tieferes, etwas Herzliches, oder etwas von Liebe und Leidenschaft. Sie hatten nur eine Leidenschaft: das Haus. Sie trugen alles ins Haus, neue Steine, neue Bretter zu Böden, neue Balken, neue Ziegel. Und aus dem Haus trugen sie altes Stroh, Mist und Dreck und fauliges Holz und waren wie zwei Vögel, die ein Nest bauen und den alten Nistkasten ausräumen. Sie wuchsen einfach zusammen, ohne zu wissen, wie und warum und wozu, und doch wußten es beide und hoben es auf für später. Bald merkte Hias nicht mehr, ob sie schön oder häßlich war, ob ihre Schürze sauber war oder nicht, ihr Haar in Ordnung oder nicht. Es war eben die Helene und für Helene war es eben der Hias, der Maurer, der Bär, der Rainerbuckel, wie man ihn im Dorfe nannte. Das ging so lange, bis sie eines Tages Streit bekamen.
Es handelte sich um einen alten Immenstand am Hintergiebel, der zu nichts mehr taugte. Er war morsch und zerfallen, die Bretter rissig und verfault, das Dach war längst abgedeckt, und wären die großen Eschen nicht gewesen, die über ihm die Äste hielten, der Wind hätte ihn schon lange weggefegt.
Hias sagte: „Das da muß auch noch weg.“
Helene sagte: „Nein, den lassen wir stehen. Hier habe ich als Kind immer gespielt.“
„Aber jetzt taugt er zu nichts mehr. Jetzt kann kein Kind mehr darin spielen.“
Helene sagte: „Ach, der hindert doch nicht. Es war so schön, hier zu spielen.“
Hias gab einer Wand einen Tritt. Ein Brett krachte ein. „Siehst du, das ist doch alles faul.“ Er wollte den Fuß wieder heben, aber sie zog ihn weg.
„Laß doch, was geht das dich an. Das ist doch mein Immenstand.“
„Eine alte Bruchbude ist das“, sagte der Bursche, „das hängt ja da wie ein Krautlandschuder.“
„Aber ich mag ihn. Ich habe darin gespielt und war so allein. Komm, schau mal hinein, wie schön das ist.“ Sie zog die Tür weg, die nur angelehnt vor der Öffnung stand. „Hier ist noch die Bank und hier die kleinen Klötze, wo ich daraufgesessen bin, und alles ist noch so wie früher.“
Hias trat nicht ein, sondern sagte: „Sieh doch, Helene, der verschandelt ja den ganzen Hintergiebel.“
„Aber es ist mein Haus gewesen, als Kind ist es mein Haus gewesen, und das laß ich nicht wegreißen, und überhaupt ist alles mein Haus und ist mein Hof, und ich will auch noch etwas zu sagen haben, verstehst du.“ Sie stand da, bleich, zitternd und sah ihm in die Augen wie eine Katze, der man ein Junges nehmen will. Sie stampfte sogar auf den Boden.
Er sah sie an. Er wurde dunkelrot im Gesicht vor Scham, vor Empörung, vor einem jähenBegreifen. Er zuckte mit den Schultern, schnaufte zweimal tief und sagte ganz ruhig, ganz gespannt ruhig: „Ja, es ist alles dein Haus und Hof, alles, alles. Ich war und bin ja nur ein Knecht.“ Er drehte sich um, der Schmollkopf, ging auf eine Esche zu, an deren Stamm die Umzäunung des Fohlengartens angenagelt war, stieg hinüber und stapfte durch das Gras, weg vom Hof.
Er hörte hinter sich rufen: „Hias! Hias!“ wandte sich aber nicht um.
Er hörte hinter sich das Gras rascheln. „Hias!“
Er fühlte sich am Arm gefaßt. „Hias! Hias! das war nicht ernst gemeint. Wir brechen den Immenstand ab. Du hast recht. Er verschandelt den Giebel. Ich war dumm. Ich war doch nur so dumm.“
Aber der Bursche ging weiter bis zum Bach.
„Sei doch nicht so.“ Sie vertrat ihm den Weg. Sie stand jetzt dicht vor ihm. „Hias bleib! Wenn ich dich bitte, gelt, dann bleibst du?“
„Ich bin ja nur Knecht“, brummte er.
„Nein, nein, Hias, wenn du nur willst, bist du nicht Knecht.“ Sie faßte ihn am Arm, drehte ihn zurück: „Komm doch! Man sieht uns hier. Komm, ich muß dir etwas sagen. Komm, man sieht uns hier auf freiem Feld.“
Der Bursche sah das ein, ließ sich zurückführen. Sie schwatzte: „Natürlich brechen wir das alte Gerümpel ab. Es war mir nur so im ersten Augenblick, als du den Fuß gegen die Wand schlugst. Es war mir nur so. Es ging mir nur ein Stich durchs Herz. Hias, weißt, es war mein Haus, mein kleines Bienenhaus. Es gehörte ganz mir, Hias; aber jetzt bin ich ja kein Kind mehr. Jetzt kann man das abbrechen.“
Sie kamen an die Umzäunung. Sie schlüpfte mitten durch. Er stieg darüber. Er sagte: „Nein, Helene, wir brechen es nicht ab.“
„Doch doch!“ rief sie hastig. „Doch doch, es taugt ja nichts, es nützt ja nichts. Komm, wir gehen gleich daran, komm!“ Sie zog ihn hin.
Er ging mit. Er ging mit ihr hinein. Sie zitterte, sie bebte. „Hias, du darfst mir nie fortlaufen! Versprich es mir! Gelt, du bleibst? Du bleibst?“ Ihr Atem flog. „Ich habe deine Mutter so gern, Hias. Du hast eine gute Mutter. Sie sagt mir immer etwas Liebes, wenn sie mich sieht. Weißt, Hias, gegen andere Menschen ist sie so kalt, und sie sagen Böses über deine Mutter, aber zu mir ist sie gut.“ Helene bekam Tränen in die Augen. Der Bursche sah sie an, ganz verdutzt. „Ist das wahr?“ fragte er. „Hast du meine Mutter gern?“
Helene nickte. Jetzt quoll es. Sie konnte sich nicht mehr halten. Sie sah ihn an wie ein gehetztes Wild.
Er schloß sie in die Arme. Er wußte nicht warum. War es seine Schwester, sein Weib oder nur ein Kind? Sie war auf einmal alles.
Sie warf leidenschaftlich ihre Arme um seinen Hals. Er hielt sie nur fest. Sie hing an ihm. Ihre Kniee versagten. Er setzte sich mit ihr auf die morsche Bank. Sie brach zusammen. Sie lachten, erhoben sich.
„Siehst du“, sagte er, „es taugt nichts mehr.“ Er nahm sie wieder in die Arme und sagte: „Ich bleib schon, Helene. Ich kann ja gar nicht mehr gehen. Ich habe das alles für uns geschafft.“
Sie bog den Kopf zurück. „Ist das wahr? O du, sag das nochmals. Ist das wahr? Hast du auch an mich dabei gedacht?“
Er strich über ihren Scheitel. „Natürlich für dich. Für wen sonst? Meine Mutter hat gesagt, du seiest das tapferste Mädchen weit und breit.“
„Was hat sie noch gesagt?“
„Ja“, sagte Hias, „sie hat gesagt, du würdest mir das nie vergessen, wenn ich dir helfe.“
„Nie, nie“, stöhnte das Mädchen, „gar nie. O!“ rief sie in einer jubelnden Seligkeit, „ich bin so stolz, so stolz, daß deine Mutter mich gelobt hat. Ich weiß, sie hat mich gern. Aber so stolz bin ich. Sie hat mich gelobt, und du, lobst du mich auch? Etwas habe ich doch auch geschafft, gelt, etwas habe ich auch getan?“
Die beiden sagten sich viel Liebes. Sie sagten es auf ihre Weise und sie küßten sich lange nicht, strichen sich nur über Schultern und Haare und lachten und warfen sich einander in die Arme und genossen den Augenblick wie Kinder ein großes Geschenk. [...]
So wurde Hias Bauer auf dem Eschhof. Er wuchs einfach hinein. Er wuchs auch in sein Glück hinein. Ich glaube, Hias hat das Wort Glück nie im Munde geführt, hat auch um sein Wesen kaum gewußt. Es lief ihm einfach nach und weil, so scheint mir, dies unverschämte, verliebte Glück ihm beinah dreißig Jahre nachlaufen mußte, ohne daß er auch nur ein Mal sich umgedreht hätte, erschlug es ihn aus Haß, aus Eifersucht, aus einer grundlosen Bosheit heraus. [409-421]
Alles weitere wäre schnell erzählt, aber gerade dieses letzte Kapitel seines Lebens wurde nach seinem Tod von allen Betroffenen mit einer Gründlichkeit und Zähigkeit, einem grausamen Hin- und Herzerren und Bohren und Zerfasern so sehr bis ins Kleinste zerkrümelt und zergrübelt, daß mich eine Übelkeit beschlich, eine tiefinnere Qual, weil das Wort Geld in jedem Sätze vorkam, dieses Wort, das schon zuvor bei unserm Kuhhandel wie ein schleimiger, schlüpfriger, ekliger Überzug auf allem gelegen war. Und ich schreibe diese Geschichte auch aus dem Grunde nieder, um zu zeigen, wo das Kindsein und damit auch das wahre Menschsein aufhört, dort, wo die quälende Sorge um Geldbesitz und Geldverlust das Leben erstickt. Immer hörte ich die Sätze: „Hätte Hias das Geld gleich ausbezahlt – hätte der Händler das Geld gleich geschickt – hätte der Hias mehr Geld aufgenommen –.“ Ich hörte die Begriffe Konto, Überweisung, Wechsel, Hypothek, Zahlungsbedingungen, Abschlagszahlung, Anleihe, Darlehen, Kreissparkasse, Bank, Girokasse, lauter mir bislang fremde Dinge, die sich mir aber mit der Hartnäckigkeit von blutgierigen Bremsen aufzwängten, weil alle in diesem Schlangenknäuel von Geldfragen die Deutung des Unglückes zu suchen schienen. Ich war jetzt in das Alter gekommen, wo mir das Leben mit harter Eindringlichkeit zu verstehen geben wollte, daß all unsere Träume, Wünsche, Sehnsüchte, unser großes Verlangen nach Welt und Weite und Tiefe abhängig sind von der kalten, nüchternen Existenz jener bunten Wertscheine, die wie ein unterirdisches Mycelgeflecht im Walde des Menschengeschlechtes die Familien, Sippen und Völker unterzieht und seine Glückspilze aufschießen läßt, giftige und eßbare, stinkende und duftende, madige und reine, schamlose und schöne. Ich konnte und wollte nicht glauben, daß nur dies leidige Geld schuldig war. Ich haßte dieses Wort, wie ich den Begriff haßte, und doch ahnte ich, daß es der Schlüssel ist für alles, der goldene Schlüssel, ohne den die Welt sich nicht öffnen läßt, auch der Mensch nicht, der Zauberstab, der über Gedeihen und Verdorren unserer Anlagen rücksichtslos gebietet. [436-437]
In die große Welt
Vater war ernst und ganz in sich gekehrt. Seine Gesichtszüge waren eingefallen. Er sah aus, als sei er aus einer schweren Krankheit auferstanden. Mit geschäftigem Eifer ging er der Arbeit nach und war noch schweigsamer denn zuvor. Kaum war die Frühjahrsbestellung der Felder vorüber, nahm er das Waldgeschäft wieder auf. Mutter und Mathilde hackten Kartoffeln und jäteten Disteln aus der Wintersaat. Ich bekam den Auftrag, meinem Vater täglich das Mittagessen in den Wald zu bringen. „Bleib ein wenig um ihn, Florian „, sagte Mutter, „vielleicht will er dir noch etwas sagen, bevor du fortgehst.“
Ich tat diesen täglichen Gang gern. Ich sah bei dieser Gelegenheit meine Heimat, die ich bald verlassen sollte, noch einmal in ihrem schönsten Schmuck. Besonders der Abschied vom Mooswäldchen fiel mir schwer. Das kleine Gehölz war mir vertraut wie Stube und Kammer. Die meisten unserer Äcker und Wiesen lagen in seiner Nähe. Jede dieser Trauftannen, die ihre Äste bis auf den Boden herunterschlappten, kannte ich auswendig. Alle hatte ich schon durchgeklettert, in jedem dieser Wipfel mich hin und her geschwungen. Ich liebte diesen kleinen Tannenschopf so sehr wie Mutter. „Das ist mein Wald“, sagte sie oft, wenn wir an seinem Rand unser Vesperbrot verzehrten. Er war auch mein Wald. Alle Beeren gab es hier. Alle Arten von Blumen umsäumten ihn. In den vielen Tümpeln wimmelte es von Fröschen, Molchen, Egeln, Käfern und Spinnen. Mehrere Quellen sprudelten im Dickicht aus dem Boden. Auch der Rotbach entsprang hier.
Der Hochwald dagegen, wo mein Vater arbeitete, war mir immer bedrohlich wie ein Ozean, in dem man ertrinken konnte. Nie betrat ich ihn ohne das Gefühl des Grauens. Hier war für mich die Welt zu Ende.
Wenn ich in diesen Tagen und Wochen dort meinen Vater traf, ganz einsam, irgendwo verloren in einer Lichtung, an einem Wurzelstück hackend, war es mir, als sei er dieser Wald, dieser große Unheimliche, den niemand bis zu Ende durchforschen kann, der immer rätselhaft bleibt, und der im Bunde steht mit Wind und Sturm, mit Wolke und Gewitter, mit Nacht und Sternen, der nur in seltenen Jahren aufblüht und sich vergeudet im Überschwang des Lebens, dann wieder versinkt in stummes Träumen.
Ich half mit, trug Wurzeln beiseite, legte mit der Hacke Stöcke bloß, übte meine Kraft an dem schweren Scheithammer oder ebnete leere Gruben ein. Auch jetzt sprach Vater nicht mit mir. Wußte er überhaupt, daß ich bald nicht mehr bei ihm sein würde? Kümmerte es ihn, oder war ich ihm so gleichgültig wie eine dieser Tannen hier? Und hätte er gesprochen, was hätte er sagen können?
Je näher der Tag meiner Abreise heranrückte, desto geschäftiger zeigte sich meine Mutter. Ich hatte mir ausbedungen, die erste Fahrt in die große Welt allein, ohne Begleitung, antreten zu dürfen, obgleich ich bis dahin noch nicht einmal eine Lokomotive zu Gesicht bekommen hatte. Meine weiteste Reise blieb jene Fahrt in die Talmühle. Den Mut zu meiner überheblichen Forderung gaben mir der Atlas und die Phantasiereisen mit dem roten Vinz. War ich nicht seit einem geraumen Jahr träumend über den schönen Landkarten gesessen? Wozu hatte ich diese Schiffahrtslinien rund um die Erde studiert? Kannte ich nicht alle Ströme, Gebirge und Meere der Erde? Besaß ich nicht einen Bilderschatz im Anhang, der mich mit den Völkern, Ländern und großen Weltwundern vertraut gemacht hatte? Und im „Stein der Weisen“, den mir Paul als Erbteil hinterlassen, fanden sich Abbildungen genug von D-Zügen, Lokomotiven, Luxusdampfern, so daß mir nicht bange war, diesen Kolossen leibhaftig gegenüberzutreten. Was war schon eine Fahrt vom Schwarzwald ins Allgäu? Ein Katzensprung, vor dem ein elfjähriger Junge nicht zurückschrecken durfte! So groß war mein Mut und nichts, keine Widerrede meiner Mutter, konnte diese starrköpfige Einbildung besiegen.
Mutter fragte bei ihrem Bruder an, was man da machen solle. Onkel Severin stellte sich zu meiner Verwunderung auf meine Seite und antwortete, wenn sein Bruder Ernst mit sechzehn Jahren allein nach Amerika gefunden habe, werde der Florian auch ihn zu finden wissen. Was so ein kleiner Gernegroß sich zutraue, solle man ihm auch zutrauen. [...]
Der Tag der Abreise war da. Frühmorgens um ein halb fünf wurde ich geweckt. Als ich in die Stube trat, saß Vater auf dem Sofa und zog sich eben Socken und Stiefel an. Auf dem Tisch stand ein großer Eierkuchen, der mit seinem knusprigen Rand über den Teller hing. Alle Lehren und Wegweisungen waren tags zuvor ausgiebig erteilt worden. Man ließ mich in Ruhe essen. Friedel kam mit einem Wuschelkopf herein und setzte sich im Unterrock neben mich. Mathilde, die mich zum Omnibus bringen sollte, packte mein Köfferchen. Mutter ging aufgeregt hin und her und wiederholte in einem fort: „Was wollt ich doch noch sagen, ich wollte noch etwas sagen, aber jetzt fällt es mir nicht ein.“
„Sagen“, knurrte Vater vom Kanapee herüber, „sagen! Ich glaub, du hast schon genug gesagt.“ Er stand auf, stellte sich ans Fenster und blickte wie immer, wenn er wartete, zu den oberen Scheiben hinaus. Mit den Worten: „Ja, ich muß in den Stall“, drehte er sich mir zu, gab mir die Hand, hielt sie eine Weile fest, sah mir in die Augen und sagte nur: „Also –“. Dann ging er.
In der Kammer meiner Eltern nahm ich Abschied von der schlafenden Hermine. Im Schlummer glich sie Agnes. Sie wachte nicht auf.
Mutter gab mir Weihwasser. Sie hatte Tränen in den Augen und konnte kein Wort mehr hervorbringen. Als Friedel mir die Hand reichte, stand sie ganz steif und hölzern vor mir und lachte verlegen. Mutter und Friedel folgten bis vors Haus und winkten schüchtern.Vater trat eben aus dem Stall, wandte sich aber unter der Tür wieder zurück, um nichts mehr sagen zu müssen. Dann ging ich neben Mathilde, die mein Gepäck trug, durch den Obstgarten, den schmalen Wiesenpfad entlang dem Dorfe zu.
Wir mußten uns beeilen. Von fern, aus der Richtung von Mariabronn, hörten wir schon den Omnibus nahen. Der Abschied von Mathilde fiel mir besonders schwer. Sie drückte meine Hand mit ihrer harten Schaffhand so fest, daß mich die Finger schmerzten. „Bleib gesund, Flore, und schreib einmal“, sagte sie nur. Ich bekam einen Platz am Fenster. Mathilde klopfte von außen an die Scheibe und winkte.
Die Sonne war schon aufgegangen. Hier und dort standen Schnitter in den Wiesen. Alles war verklärt wie von einem Zauber. Die Wälder standen frisch und saftig rings um mein Heimatdorf, das von der Höhe aus in seiner Talschüssel zwischen Obstgärten langsam den Blicken entschwand. [...]
Wo war ich? Niemand fragte mich, wohin ich wolle. Jeder war auf sich selbst gestellt. Zu fragen getraute ich mich nicht.
Der Regen hörte auf. Ein Fenster wurde geöffnet. Wir befanden uns in einer flachen Landschaft. Ich sah einen hohen gewaltigen Berg mitten aus der Ebene aufragen, bald einen zweiten und einen dritten. Wie hießen diese Berge?
Der Stolz auf meine erdkundlichen Kenntnisse erlitt eine Demütigung nach der andern. Wie heißt dieser Fluß? Wie heißt diese Stadt? Wo ist Norden, wo ist Süden? Nichts weißt du, Florian, gar nichts weißt du. Auf dem Atlas, gelt, da waren neben Flüssen, Bergen und Städten immer gleich auch die Namen angeschrieben. Aber Namen gibt es nur auf dem Papier. Die Wirklichkeit ist namenlos. Alles ist namenlos.
Wie herrlich hattest du dir das im Geiste ausgemalt. Den Atlas auf den Knieen, an einem Fenster sitzend, wolltest du die Reise genießen und an Hand deines Fahrplanes eine Station nach der andern schön gemächlich erleben. [442-448]
Es war abends gegen neun Uhr, als ich in Hergatz hören mußte, daß mein Zug nach Wangen erst um elf Uhr abgehe. Sollte ich wieder warten, oder einfach auf eigene Faust das Dorf meines Onkels suchen? Es konnte von hier aus nicht mehr weit sein. Wozu erst nach Wangen fahren und dort übernachten? Ich fragte im Bahnhof nach dem Weg. Roggenweiler, sagte man mir, liege nur eine Stunde entfernt an der württembergisch-bayerischen Grenze.
Ich verließ den Bahnhof und ging fürbaß in der Richtung, die mir ein Mann gewiesen hatte.
Es dunkelte bereits. Die Sonne mußte schon untergegangen sein. Der Himmel war immer noch von düsteren Wolken verhangen. Die nasse Straße ging bald in einen schmalen Fahrweg über, der gute zwei Kilometer am Bahndamm entlangführte. Auf dem Weg hüpften scharenweis kleine Frösche, daß ich bei jedem Schritt achtgeben mußte, um keinen zu zertreten. Aus einem Wasserlauf nebenan quakte es und raschelte es, klatschte und unkte. Die Luft roch nach Sumpf und Ried. Der Weg verließ das Bahngeleise und führte zu einem nahen Wald. Es war ein Laubwald. Ich hatte noch nie einen Laubwald gesehen. In meiner Heimat gab es nur Tannen, Fichten und Föhren.
Kaum hatte ich das Blätterdach über mir, war es so dunkel, daß man die Stämme nicht mehr unterscheiden konnte. Das Tappen und Klatschen der Frösche auf dem Weg erschreckte mich. Ich ging rascher, um recht schnell aus dem Wald herauszukommen.
Da stand ich vor einer Wegkreuzung. Welches war der richtige Weg? Ich wählte den breiteren. Nach einer Weile ging dieser in einen Rasenweg über und verschwand zuletzt in einem Unterholz.
Es war jetzt ganz Nacht. In der einen Hand trug ich den Koffer, mit der anderen tastete ich vor mich hin. Mein Herz schlug mir bis zum Hals herauf. Verirrt!
Das Wort verirrt spielte in meiner Phantasie eine schaurige Rolle. Wenn wir zuhause im Hochwald in den Beeren gewesen waren, hatten wir von fast nichts anderem geredet als von der einen großen Gefahr des Verirrens. Es kam vor, daß Kinder sich bis zur Talmühle hinunter verliefen, es kam vor, daß sie im Glauben, sich verirrt zu haben, im eigenen Wald um Hilfe schrieen.
Und ich – ich verirrte mich irgendwo in einem bayrischen Wald und tastete mich von Stamm zu Stamm, planlos, ziellos, nur in der Hoffnung, wenigstens aus dem Irrgarten herauszukommen. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ich sah Sterne auf- und niedertanzen, sah grüne Punkte aus den Gräsern schimmern, oft Dutzende, oft nur einzelne, und wußte nicht, tanzen sie in meinem Kopf oder in der Wirklichkeit. Was war das? In meiner Heimat gab es keine Leuchtkäfer.
Ich weiß, ich weinte nicht, ich betete auch nicht. Das Entsetzen war zu groß. Ich lief und lief.
Manchmal flatterten Vögel auf oder ein Getier schlich über den Weg oder es schrie ein Kauz, daß mir das Gruseln den Rücken hinunterrann.
Zuletzt wurde es zu viel. Ich lehnte mich an einen Stamm, verhielt mit keuchendem Atem. Es hatte keinen Wert. Wohin wollte ich? Der Wald nahm kein Ende. [...]
Ich bog vom Weg ab, stieg über eine Umzäunung und hastete einen Hang hoch, einen Hang hinunter, wieder einen hoch, stapfte durch Ährenfelder, Rübenäcker, Wiesen und Büsche. Dicht vor mir schlug wieder ein Hund an, ich hörte seine Kette rasseln. Sofort lief ich zurück auf eine Anhöhe, wo ich die Umrisse eines Baumes erkannte. Unter dem Baum lag ein Stoß Hopfenstangen. Ich sank auf die Stangen und schlotterte am ganzen Leib.
Die Hunde ringsum heulten. Sie riefen es einander zu: dort ist er, dort oben. Mit letzter Mühe erkletterte ich den Baum und setzte mich in eine Astgabel. Hier war ich sicher.
Vor mir dehnte sich ein graues Meer. War es Nebel? War es nur die Nacht? Ich sah kein Licht mehr. Alles, was Schnauze hatte, bellte und heulte ringsumher aus unsichtbaren Gehöften. Dazwischenhinein klang deutlich und nah der Schlag einer Turmuhr. Ich zählte zwölf Schläge.
Mein Sitz war unbequem. Ich fror. Die Nacht war kalt. Als die Hunde sich wieder beruhigt hatten, kletterte ich herunter, öffnete meinen Koffer und tastete nach einem warmen Pullover. Dabei kam mir auch ein wollenes Halstuch in die Hände. Mutter hatte es gestrickt. Ich drückte mein Gesicht hinein. Es roch nach Heimat, nach Stube, nach Tundersdorf, nach Schwarzwald.
Ich dachte an meine Mutter. O Mutter, wenn du mich so sitzen sähest, mitten in der Nacht, auf einem Stoß Hopfenstangen, in fremdem Land, unter freiem Himmel, im kalten Nebel, und wenn du um meine letzten Stunden wüßtest, um den Hund, der mich zu Boden geworfen, um den fürchterlichen Wald, zutode würdest du erschrecken, Mutter. Da riß es hin und her in meiner Brust, da half kein Tapfersein, kein Furchtlos und Treu. Das war viel schlimmer als mein erster Kommuniontag, viel schlimmer als meine Wallfahrt und alles, was ich je erlebt hatte. Nein, es war keine Feigheit zu heulen und zu schluchzen.
Das war die Strafe, die große Strafe für den Hartschädel, den Dickkopf, den Wer-bin-ich. Ja, wer bin ich? Ein kleines Klümpchen Elend, das bist du, sonst nichts. Ein lächerlicher Gernegroß, dem der Herrgott den Hosenboden versohlt hat.
All dies quoll auf aus dem warmen Halstuch, aus dem ich die Erinnerung meines ganzen Lebens sog. Es mußte herunter von der Seele, alles mußte herunter. Eine gründliche Gewissenserforschung war nötig. Du bist allem untreu geworden, deinem Schutzengel, deinen Eltern, deinem Pfarrer und Lehrer. Immer wolltest du obenhinaus. Alles hast du besser gewußt. Wer bin ich? hast du gesagt und geglaubt, die Welt drehe sich um dich. Sogar an Gott hast du gezweifelt und gefragt: Wer ist Gott? Sieht man ihn? Hört man ihn? Kein wildes Tier hat dich angefallen, kein Bär, kein Wolf, nur ein gemeiner Hofhund. Ja, dein Atlas und deine großen Weltreisen auf dem Papier, da fing dein Hochmut an. Wie leicht war es, in der Schule aufzutrumpfen und zu sagen: ich weiß, wo Honolulu liegt, ich weiß, wie hoch der Chimborasso ist, ich kann die Ströme Afrikas herzählen, aber wo du jetzt bist, das weißt du nicht, da läßt dich dein Atlas im Stich. Die Welt ist kein Atlas. Sie hat keine Grenzen und Namen, und die Straßen kann man nicht sehen, wenn es Nacht ist. Die Welt ist anders, wenn es regnet, und ist anders, wenn es Nebel hat. Sie ist naß und buckelig, und dreckig ist sie. Gelt, das steht nicht im Atlas. Dort ist alles eben und glatt und farbig wie auf einem Zichorienbildchen. Und was ein Maßstab ist, davon hast du jetzt vielleicht eine Ahnung. Eins zu eins, so heißt der Maßstab. Mensch und Welt, nicht eins zu einer Million, das war dir bis jetzt Nebensache. Nun ist es Hauptsache geworden. Das ist der richtige Maßstab: der kleine Florian, den jeder Hund umwerfen kann, und die große, dunkle Welt.
Heul nur in dein Halstüchlein hinein, du Dickkopf! Zurück willst du wieder? Heim, zu deiner Mutter? Nein, jetzt wird geblieben, Menschlein I Hindurch mußt du, durch Nacht und Nebel, durch Dreck und Dickicht, durchs wahre Leben. Und dafür gibt es keinen Atlas, keine Karten, Florian. Riechst du es schon, das wahre Leben, spürst du, wie es dich anfaßt? Kalt ist es und unfreundlich, gefährlich, und voll Nebel. Dafür gibt es keine Fahrpläne, höchstens einmal einen Wegweiser, und das ist der Mensch, der Andere. Das ist die Mutter, der Vater, der Onkel, aber du wolltest ja deinen eigenen Weg suchen.
Das Halstuch war naß geworden über dieser Selbstzerknirschung. Mittlerweile hatten die guten Geister der Natur wieder die Oberhand gewonnen. Ein lauer Wind scheuchte die Nebel weg. Sterne traten aus den Wolken vor, erst hier und dort, dann überall. Die Hunde schwiegen. Aus dem Tal herauf schlug die Glocke ein Uhr. Das große Schweigen der Nacht stillte langsam den Aufruhr in meiner Brust. Eine Müdigkeit legte sich wie ein schwerer Mantel über mich. Ich richtete mir auf den Hopfenstangen eine Liegestatt zurecht, als Kopfkissen die weißen Wäschestücke, als Decke alle Kleider, die sich in meinem Koffer befanden, und legte mich hin. Dann sprach ich, wie ich von daheim gewohnt war, laut mein Nachtgebet. Heute dachte ich etwas dabei. „Bevor ich mich zur Ruhe leg – ich Händ’ und Herz zu Gott erheb...“
Ein Windhauch strich über mein Gesicht.
Als ich erwachte, brauchte ich geraume Zeit, um mich zurechtzufinden. Wo war ich? Über mir lachten Tausende und Abertausende schwarzer Kirschen. Die Äste neigten sich tief unter der süßen Last. Eine rötliche Glut strahlte durch das Gezweig. Vögel sangen und zwitscherten. Glocken läuteten vom Tal herauf. Ein Schnitter kam des Weges, sah mich auf dem Stangenhaufen sitzen, blieb stehen und bot mir freundlich einen guten Morgen. Ich erzählte ihm von meiner Irrfahrt. Er trat zur Seite und wies nach dem Dorf am Fuße des Hügels. „Da, da!“ sagte er, „das ist ja Roggenweiler. Das große Haus neben der Kirche ist das Pfarrhaus, dort wohnt der Herr Dekan.“
Wie ich noch schlaftrunken das Dorf mit seinem breiten, stumpfen Kirchturm anstarrte und meine Blicke weiter über die Häuser weg in die Ferne sich verloren, durchzuckte mich plötzlich ein jäher freudiger Schreck. Was war das? War ich wirklich wach oder träumte ich einen überwältigenden Märchentraum? Soweit das Auge reichte, standen von Purpur übergossen Berge neben Bergen, keine dunklen Höhenzüge wie meine Schwarzwaldberge, nein, spitze, helle, himmelragende Schroffen: die Alpen! die Alpen!
Vergessen war, was ich in der Nacht und am Vortage an Kümmernissen und Enttäuschungen erlebt. So hatte ich mir die Alpen nicht in den kühnsten Träumen vorgestellt, so groß, so über alle Maßen hoch und erhaben. Gipfel an Gipfel wuchsen sie in den glühenden Himmel hinein. Und als die Glut schwand, begannen sie in der Morgensonne zu gleißen. Grelle Schneefelder leuchteten auf. Licht und Schatten schieden sich scharf wie an Steinkanten. Zwischen blendendem Weiß und nächtlichem Dunkel floß weit in die Tiefe die blaue Luft um die Bergwände.
Andächtig, voll tiefer Ergriffenheit trank ich die unermeßliche Schönheit in mein morgenwaches Herz. Ein Jubeln und Jauchzen erfüllte mich. Ich war am Ziel! Das war meine neue Heimat. Jetzt bangte mir nicht mehr vor Onkel Severin, vor meiner Zukunft. Ein Gefühl der Kraft stieg in mir auf und straffte meinen Körper. Ich war entschlossen, dies alles, was ich hier sah, zu erobern und nicht mehr loszulassen. O Mutter! du solltest jetzt neben mir stehen. Was würdest du sagen, Mutter? „Kind“, würdest du sagen, „ist das nicht ein Gebet?“'
Tief aus fernstem Erinnern tauchte ein Bild empor: unser Kastanienbaum im Rauhreif, als ich Mutter in erschrockener Freude fragte: „Wer hat das getan?“ Damals fiel das Wort Gott zum ersten Mal in meine Seele. Jetzt stand es wieder vor mir, gewaltiger, umfassender, nicht nur als Wort, sondern als Macht, die in die Brust griff und die Schale der Kindheit, die meine enge Heimatwelt umschlossen hatte, von mir brach, um den Raum zu schaffen für die Aufnahme der großen, weiten Welt. [453-459]